Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SONNENBERGER, HANS JÜRGEN |
|---|
| Source / Fundstelle: | ZEuP 2017, S. 6 - 67 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Zeitschrift für Europäisches Privatrecht |
|---|
| Année / Jahr: | 2017 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Schuldrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Reform, Schuldrechtsreform, SCHULDVERHAELTNIS, VERTRAGSRECHT |
|---|
 Zusammenfassung des Autors
Zusammenfassung des Autors:
Durch die ordonnance vom 10.02. 2016, die mit Einbringung eines Ratifizierungsgesetzes am 06.07. 2016 in das parlamentarische Ratifizierungsverfahren in Kraft getreten und ab 01.10. 2016 anzuwenden ist, wurde das allgemeine Vertragsrecht und das Recht des Beweises von Verträgen des Code civil reformiert und ein neuer Abschnitt „Regime schuldrechtlicher Verpflichtungen“ in das Gesetzbuch eingeführt. Gegenstand des Artikels ist eine einführende Darstellung und Würdigung des allgemeinen Vertragsrechts, soweit es sich um erhebliche Veränderungen des bisherigen Rechts handelt, ergänzt durch Vergleiche mit dem deutschen Recht. Das Regime schuldrechtlicher Verpflichtungen wird im zweiten Artikel folgen.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung
1. Zur neuen Ordnung
2. Zum Inhalt der Reform
3. Zur Rechtsform
II. Drittes Buch des Code Civil, Titel III: Die Quellen der Schuldverhältnisse, Art. 1100 - 1304-4 Code civil (neu)
1. Das Schuldvertragsrecht, Titel III, Untertitel I Code civil
a) Grundlagen, Kapitel I
b) Der Vertragsschluss - Kapitel II
aa) Die Verhandlungsphase
bb) Die Abschlussphase
cc) Vertragliche Vereinbarungen vor einem Vertragsschluss
dd) Elektronische Technik beim Abschluss eines Vertrages
c) Gültigkeit und Inhalt des Vertrages
aa) Vorbemerkungen
bb) Der consentement
cc) Geschäftsfähigkeit, capacité, und Stellvertretung, représentation
(i) Allgemeines und capacité
(ii) Stellvertretung
dd) Der Inhalt des Vertrages
d) Nichtigkeit und Hinfälligkeit des Vertrages, nullité und caducité
e) Die Auslegung von Verträgen - Kapitel III
f) Die Vertragswirkungen - Kapitel IV
aa) Die Wirkungen für und gegen die Parteien
bb) Die Wirkungen betreffend Dritte
cc) Die Dauer des Vertrages
g) Abtretung des Vertrages
h) Die Nichterfüllung (Leistungsstörung) und ihre Folgen
2. Außervertragliche Schuldverhältnisse, Untertitel II und III
a) Vorbemerkungen
b) Geschäftsführung ohne Auftrag, Untertitel III, Kapitel I
c) Ungerechtfertigte Bereicherung, Untertitel III, Kapitel II und III

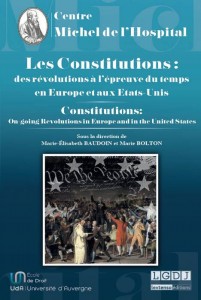 Il n'existe pas de synchronie entre le droit et les idées constitutionnelles française et allemande. La Révolution française, en particulier, a moins servi d'inspiration initiale que la Restauration par la Charte de 1814 qui illustrait la possibilité d'une monarchie "limitée".
Dans un premier temps le constitutionnalisme est envisagé par la majorité de la doctrine allemande comme un simple acte de limitation du pouvoir, sans que la théorie de la constitution et la théorie de l'Etat ne soient liées. Le pouvoir étatique est envisagé comme préexistant à la constitution.
Une fois affirmé le principe démocratique, la Constitution est envisagée comme fondant le pouvoir du gouvernement. L'article 1er de la Constitution de Weimar l'exprime parfaitement (La Souveraineté émane du peuple - Die Staatsgewalt geht vom Volke). L'émergence de cette idée d'une "transcendance" du pouvoir constituant peut être suivie à travers l'évolution de l'histoire constitutionnelle allemande, de la Paulskirchenverfassung de 1848, à travers la Constitution de Weimar jusqu'à la Grundgesetz.
Il n'existe pas de synchronie entre le droit et les idées constitutionnelles française et allemande. La Révolution française, en particulier, a moins servi d'inspiration initiale que la Restauration par la Charte de 1814 qui illustrait la possibilité d'une monarchie "limitée".
Dans un premier temps le constitutionnalisme est envisagé par la majorité de la doctrine allemande comme un simple acte de limitation du pouvoir, sans que la théorie de la constitution et la théorie de l'Etat ne soient liées. Le pouvoir étatique est envisagé comme préexistant à la constitution.
Une fois affirmé le principe démocratique, la Constitution est envisagée comme fondant le pouvoir du gouvernement. L'article 1er de la Constitution de Weimar l'exprime parfaitement (La Souveraineté émane du peuple - Die Staatsgewalt geht vom Volke). L'émergence de cette idée d'une "transcendance" du pouvoir constituant peut être suivie à travers l'évolution de l'histoire constitutionnelle allemande, de la Paulskirchenverfassung de 1848, à travers la Constitution de Weimar jusqu'à la Grundgesetz.
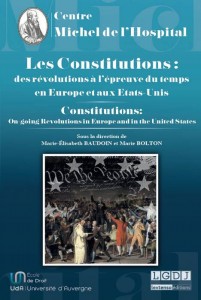 Lectures complémentaires conseillées :
Hummel (Jacky), Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF ("Leviathan"), 2002.
Lectures complémentaires conseillées :
Hummel (Jacky), Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF ("Leviathan"), 2002.




