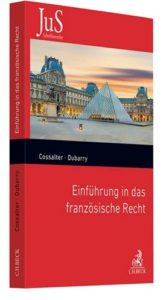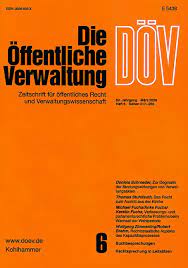Fév 25, 2025

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem franzöischen öffentlichen Recht der sog. Bioethik, d.h. die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eingriffe in den menschlichen Körper von besonderer ethischer Sensibilität (Transplantationsmedizin, Stammzellenforschung, Embryonenschutz etc.) und der Rechtsprechung des Conseil d'États in diesem Rechtsgebiet. Die Autoren betonen dabei die besondere Kohärenz des französischen Modells, dasauf den Grundprinzipien der Würde, der Freheit und der Solidarität beruht.
Oct 15, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | COSSALTER, PHILIPPE; DUBARRY, JULIEN |
|---|
| Source / Fundstelle: | C.H. Beck |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Allgemeines, Familienrecht, juristische Ausbildung, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Staatsrecht, Strafprozeßrecht, Strafrecht, Verfassungsprozeßrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsprozeßrecht, Verwaltungsrecht, Zivilprozeßrecht, Zivilrecht |
|---|
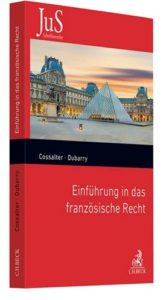
Die Einführung gibt einen Überblick über die Rechtsinstitution unseres Nachbarlandes Frankreich. Sie geht dabei besonders auf das materielle Recht ein. Der Band zeigt vor allem die kennzeichnenden Lösungsansätze der Rechtsordnung und die abweichenden Wege auf, die das französische Recht beschritten hat. Dabei liegt der Fokus auf den seit der letzten Auflage eingetretenen Entwicklungen in den jeweiligen Materien. Die dynamische Darstellung erlaubt es, Schwerpunkte bei gegenwärtigen Fragestellungen zu setzen. Neuere Literatur und Rechtsprechung werden dabei berücksichtigt.
"Das Werk hat an Textumfang gewonnen (die erste Auflage umfasste 192 Seiten, die vorliegende 438 Seiten). Diese bemerkenswerte Erweiterung ist natürlich auf die – übermäßige? – Zunahme des französischen Normbestands zurückzuführen, aber auch auf das Bestreben der Autoren, sowohl die Grundzüge des französischen Rechts zu skizzieren und gleichzeitig so präzise wie möglich zu sein. Philippe Cossalter und Julien Dubarry gelingt es hervorragend, diesen scheinbar widersprüchlichen Anspruch zu erfüllen, indem sie jeden Rechtsbereich klar darstellen, vertiefende Hinweise auf die französische und deutsche Rechtsliteratur geben und eine leicht verständliche Gliederung vorlegen." (Geleitwort von Vlad Constantinesco).
"Seit der 4. Auflage der 2001 erschienenen Einführung von Hübner/Constantinesco hat sich in der französischen Rechtsordnung so viel geändert, dass es uns angebracht erschien, das Werk von vorneherein neu zu konzipieren. Nichtdestotrotz vergessen wir nicht, was wir unseren Vorgängern zu verdanken haben: Sie haben ein Buch konzipiert, das zahlreichen Generationen von Praktikern und Studierenden an deutschsprachigen Hochschulen das französische Recht nähergebracht hat. Auch uns persönlich haben sie geprägt. Julien Dubarry durfte die Vorlesungen Hübners im deutschen Deliktsrecht und im französischen Recht an der Universität zu Köln genießen, so dass diese Erinnerung die Redaktion der zwei letzten Teile des Buches (Strafrecht und Privatrecht) stets begleitet hat. Philippe Cossalter hat die Teile 1 (Allgemeine Einführung) und 2 (Öffentliches Recht) verfasst. Auf die Darstellung der jeweiligen Sondergebiete wurde in dieser ersten Auflage, die sich im Übrigen hauptsächlich mit dem materiellen Recht befasst, verzichtet. Trotz dieser Arbeitsaufteilung wurden wir von einem gemeinsamen Ziel getrieben: eine zuverlässige, knappe und doch praxistaugliche Darstellung des geltenden Rechts anzubieten und eine Vertiefung durch Hinweise auf sorgfältig ausgewählte weiterführende französische Literatur in den Fußnoten zu ermöglichen. Literatur und Rechtsprechung konnten größtenteils bis Februar 2023 berücksichtigt werden." (Vorwort von Philippe Cossalter und Julien Dubarry).
Sep 28, 2023
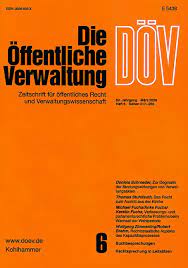
Oft wird die Vermutung geäußert, dass sich Einheitsstaaten bei der Digitalisierung der
Verwaltung deutlich leichter tun. Daher soll in diesem Beitrag ein vergleichender Blick auf die Herangehensweise in
Estland und
Frankreich geworfen werden.
In
Frankreich ist heute kaum noch vom „gouvernement électronique“ oder kurz e-gouvernement die Rede. Stattdessen finden sich Formulierungen, die an die Übersetzung des Wortes „digital“ mit „numérique“ anknüpfen. Parallel zum Entwicklungsfortschritt bei den digitalen Werkzeugen hat sich die elektronische
Verwaltung im Laufe der Zeit fortentwickelt. Zur Umsetzung der Digitalisierung wurden viele neue Gremien gebildet (Commission d’accès aux documents administratifs, Commission nationale informatique et libertés, L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).
Es gibt diverse besondere und allgemeine Vorschriften zur elektronischen
Verwaltung. Unter anderem wird in Art. D. 113-2 und Art. D. 113-3 CRPA festgelegt, dass die für die Durchführung eines Verfahrens erforderlichen Formulare der
Öffentlichkeit kostenlos in digitaler Form über die
öffentliche Website „service-public.fr“ zur Verfügung gestellt werden müssen und die Verwaltung die Bearbeitung eines mit einem solchen Formular eingereichten Antrags nicht verweigern darf. Vor allem die Art. L. 112-7 ff. CRPA enthaltenen Vorschriften zur elektronischen Verfahrensabwicklung. Zudem steht hierfür seit 2021 die eingeführte nationale elektronische Identifizierungskarte zur Verfügung. Der französische Conseil d’État entschied, dass sich aus Art. L. 112-8, L. 112-9 und L. 112-10 CRPA zwar ein Recht auf elektronische Kommunikation mit der
Verwaltung, aber keine Verpflichtung dazu ergibt.
Im Unterschied zu Deutschland und Österreich mit ihren
E-Government-Gesetzen sind in
Frankreich zentrale Vorschriften zur elektronischen
Verwaltung in seiner Kodifizierung des allgemeinen Verwaltungsrechts enthalten. Der Rückstand
Frankreichs bei den digitalen
öffentlichen Diensten wird u.a. mit dem tendenziell eher schlechten Verhältnis der Bürger zur
Verwaltung und den Schwierigkeiten mancher Bürger bei der Inanspruchnahme digitaler
öffentlicher Dienste erklärt, etwa weil sie nicht ausreichend digital kompetent sind
Sep 28, 2023
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SCHNIEDERS, RALF |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Klima und Recht, C.H. Beck, S. 226-229. |
|---|
| Année / Jahr: | 2023 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtspraxis, Umweltrecht, Verwaltungsrecht |
|---|

Die
französische Verwaltungsrechtsprechung hat in jüngerer Zeit mehrfach den
französischen Staat verurteilt, Maßnahmen zu ergreifen, um nicht erfüllte gesetzliche Klimaschutzziele umzusetzen. In einem Verfahren geschah dies auf dem Weg eines primären Erfüllungsanspruchs, in einem anderen Fall als sekundärer Schadensersatzanspruch.
Die Urteile der französischen Verwaltungsgerichte erkennen an, dass die Realisierung konkreter Treibhausgasreduktionsziele, die sich der
französische Staat in Umsetzung der völker- bzw. unionsrechtlich eingegangenen Verpflichtungen innerstaatlich selbst auferlegt hat, für Gebietskörperschaften und für Umweltverbände gegenüber dem Staat einklagbar ist. Dies ermöglicht in dem Verfahren „Grande-Synthe“ vor dem CE (Entscheidungen vom 19. 11. 2020 und vom 1. 7. 2021) ein weites Verständnis der subjektiven Betroffenheit der Gemeinden durch unterlassene Klimaschutzmaßnahmen. In dem Verfahren „affaire du siècle“ vor dem VG Paris (Tribunal administratif de Paris vom 3.2. 2021 und vom 1.7. 2021) ist die Verurteilung des Staates Folge einer weiten Konzeption des Begriffs des Umweltschadens in Verbindung mit einer entsprechenden Klagebefugnis der Umweltverbände. Beide Urteile wären folglich in der deutschen Rechtsordnung so nicht denkbar, da einerseits den Gemeinden bislang kein derart weit reichendes subjektives Recht zugestanden wurde, andererseits kein vergleichbarer weit reichender Umwelthaftungstatbestand existiert.
Der Mehrwert derartiger Urteile erscheint fraglich, er dürfte vorwiegend deklaratorischer Natur sein, dabei den ohnehin bestehenden politischen und rechtlichen Druck zu Emissionsminderungen verstärken. Bereits Unionsrecht verpflichtet dazu, verschärfte - wiederum in einem politischen Abwägungsprozess definierte - Einsparziele und Maßnahmenprogramme für kommende Emissionszeiträume zu beschließen, im Rahmen derer dann auch die gesetzlich für vergangene Zeiträume festgelegten und nicht realisierten Reduktionen nachzuholen sind. Zwangsgelder verhängten die Gerichte in dem Zusammenhang bislang nicht.
Die Gerichte fordern indes von der Regierung ausdrücklich kurzfristige Maßnahmen ein. Damit stehen sie im Kontrast zur Politik (verstanden als Regierung und Gesetzgeber), die vorzugsweise längerfristige, über Legislaturperioden hinausweisende Einsparungsziele aufstellt.
Sep 11, 2023
 Zusammenfassung des Beitrags:
Zusammenfassung des Beitrags:
Anders als bei den meisten Umweltbedrohungen, etwa im Bereich der Biodiversität, der Auslaugung der Böden, der Luft- oder der Wasserverschmutzung, bei denen der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung vorwiegend auf lokaler Ebene zu beobachten ist, verhält es sich beim Klimawandel: Wenn irgendwo auf der Welt eine Tonne Treibhausgas (THG) ausgestoßen wird, betrifft dies den gesamten Planeten und die gesamte Menschheit gleichermaßen. Aus dieser Interdependenz ergibt sich das Grundprinzip einer gerechten Verteilung von Verpflichtungen, das sich vom klassischen völkerrechtlichen Grundprinzip der Gegenseitigkeit unterscheidet. Es ist die Basis der seit Kyoto getroffenen internationalen Vereinbarungen, insbesondere des Übereinkommens von Paris von 2015, und sollte konsequenterweise durch einen internationalen Rechtsprechungsmechanismus abgesichert werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wird die gerichtliche Kontrolle der Einhaltung dieser Verpflichtungen auf die Ebene der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten verlagert, und das, obwohl die einzelstaatliche Verantwortung für die Verschärfung des Klimawandels aufgrund der geschilderten Umstände enorm abgeschwächt („verwässert“) ist. Die nationalen Gerichte stehen vor der Aufgabe, Verpflichtungen zu festigen, die ihren Ursprung und ihre Kohärenz im Völkerrecht haben und somit vom Willen der Staaten abhängig bleiben, und diese Verpflichtungen mit anderen allgemeinen Rechtsgrundsätzen in Einklang zu bringen..
Gliederung des Beitrags:
I. Die Klimagerechtigkeit im Rahmen des Anfechtungsverfahrens: Rechtssache Gemeinde Grande-Synthe
II. Die besonderen Schwierigkeiten im Verfahren der Staatshaftung: das „Verfahren des Jahrhunderts“
III. Offene Fragen für die Zukunft

 Der Beitrag beschäftigt sich mit dem franzöischen öffentlichen Recht der sog. Bioethik, d.h. die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eingriffe in den menschlichen Körper von besonderer ethischer Sensibilität (Transplantationsmedizin, Stammzellenforschung, Embryonenschutz etc.) und der Rechtsprechung des Conseil d'États in diesem Rechtsgebiet. Die Autoren betonen dabei die besondere Kohärenz des französischen Modells, dasauf den Grundprinzipien der Würde, der Freheit und der Solidarität beruht.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem franzöischen öffentlichen Recht der sog. Bioethik, d.h. die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eingriffe in den menschlichen Körper von besonderer ethischer Sensibilität (Transplantationsmedizin, Stammzellenforschung, Embryonenschutz etc.) und der Rechtsprechung des Conseil d'États in diesem Rechtsgebiet. Die Autoren betonen dabei die besondere Kohärenz des französischen Modells, dasauf den Grundprinzipien der Würde, der Freheit und der Solidarität beruht.