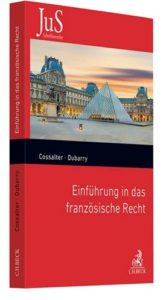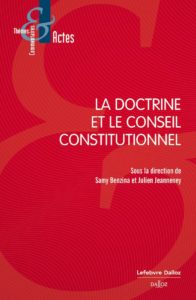Déc 3, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GERHOLD, MAXIMILIAN |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Mohr Siebeck, Reihe: Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, 2023. |
|---|
| Année / Jahr: | 2023 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Verfassungsrecht |
|---|
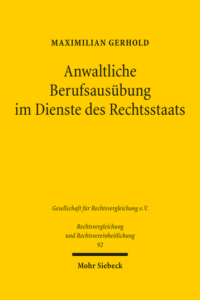
"Das Anwaltsrecht ist aus Sicht des Verfassungsrechtlers nicht nur das Recht eines Standes oder einer Profession, sondern Ausformung des Gerichtswesens und auch Recht und Staat als solches finden ihren Spiegel in ihm."
Die Arbeit befaßt sich mit der Rechtsstellung des Rechtsanwalts in Frankreich und Deutschland, namentlich der verfassungsrechtlichen Dimension. Dazu beleuchtet der Autor den verfassungsrechtlichen Schutz der anwaltlichen Berufsausübung im deutschen und französischen Verfassungsrecht und zeigt auf, inwieweit die nationalen Verfassungsrechte sich trotz grundsätzlicher und dogmatischer Unterschiede gegenseitig Impulse geben können. Der Fokus liegt insbesondere darauf, dass die Anwaltschaft kein gewöhnlicher wirtschaftlich orientierter Beruf ist, sondern eine Tätigkeit, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle innerhalb des Staatsgefüges einnimmt. Dabei sind die Anwälte nicht direkt in die staatliche Struktur eingebunden. Der Autor verwendet hierfür den Begriff der "dienenden Freiheit".
Nach einer ausführlichen Einleitung, behandelt der Autor in einem ersten Teil den besonderen Status des Rechtsanwalts. Sodann untersucht er in einem zweiten Teil die subjektiv‐rechtliche und in einem dritten Teil die objektiv‐rechtliche Dimension der anwaltlichen Freiheit. Die Arbeit schließt er mit einer knappen deutschen Bilanz und einer ausführlicheren französische Zusammenfassung ab.
Nov 25, 2024

Zusammenfassung des Autors: Paritätisches Wahlrecht hat zum Ziel, geschlechtergerechte Zugangsmöglichkeiten zum Parlament zu schaffen. Der Autor betrachtet die in Deutschland kontrovers diskutierte Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit aus rechtsvergleichender Perspektive. Die verfassungsrechtliche Lage in Frankreich steht dabei in erstaunlichem Kontrast zur deutschen Diskussion. Dazu beginnt die Autorin mit einer Begriffsbestimmung von Parität und Frauenquoten und gibt einen Überblick über Modelle zur Steigerung des Frauenanteils in politischen Gremien. Anschließend folgt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in beiden Ländern sowie ein historischer Überblick zur Entwicklung des paritätischen Wahlrechts. Es werden mögliche Beeinträchtigungen durch das paritätische Wahlrecht erörtert, insbesondere im Hinblick auf die Gleichheit und Freiheit der Wahl sowie die politischen Parteien. Abschließend untersucht die Autorin Rechtfertigungsmöglichkeiten und die Umsetzung paritätischer Maßnahmen im deutschen und französischen Recht, um deren Zulässigkeit zu beurteilen.
Nov 25, 2024

Une influence accrue des citoyennes et citoyens est désormais réclamée, que ce soit dans la rue, ou dans le cadre de nouveaux formats démocratiques tels que les conventions citoyennes ; un concept, qui, en Allemagne, n’en est qu’à ses débuts. Dans cette perspective, la question clé est celle de l’espace constitutionnel envisageable pour un approfondissement de la participation citoyenne à la formation de la loi.
La première partie de l'article souligne l'ambivalence du discours constitutionnel allemand en ce qui concerne l'implication de tiers dans la législation : Alors que les associations et les acteurs économiques participent à l'élaboration de la législation, ce n'est pas le cas des citoyens. Dans une deuxième partie, la fonction d'exemple de la Convention des citoyens pour le climat est analysée, car il s'agissait, selon l'auteur, d'une sorte de « pré-législation » qui s'accompagnait également d'un effet contraignant pour les institutions politiques, dépassant ainsi les expériences allemandes dans ce domaine. Dans une troisième et dernière partie, l'auteur résume comment ces différentes approches ont permis aux deux pays de s'inspirer mutuellement et de trouver des solutions aux demandes de la société de participer davantage à l'élaboration des lois.
Oct 15, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | COSSALTER, PHILIPPE; DUBARRY, JULIEN |
|---|
| Source / Fundstelle: | C.H. Beck |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Allgemeines, Familienrecht, juristische Ausbildung, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Staatsrecht, Strafprozeßrecht, Strafrecht, Verfassungsprozeßrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsprozeßrecht, Verwaltungsrecht, Zivilprozeßrecht, Zivilrecht |
|---|
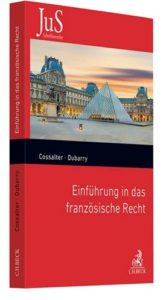
Die Einführung gibt einen Überblick über die Rechtsinstitution unseres Nachbarlandes Frankreich. Sie geht dabei besonders auf das materielle Recht ein. Der Band zeigt vor allem die kennzeichnenden Lösungsansätze der Rechtsordnung und die abweichenden Wege auf, die das französische Recht beschritten hat. Dabei liegt der Fokus auf den seit der letzten Auflage eingetretenen Entwicklungen in den jeweiligen Materien. Die dynamische Darstellung erlaubt es, Schwerpunkte bei gegenwärtigen Fragestellungen zu setzen. Neuere Literatur und Rechtsprechung werden dabei berücksichtigt.
"Das Werk hat an Textumfang gewonnen (die erste Auflage umfasste 192 Seiten, die vorliegende 438 Seiten). Diese bemerkenswerte Erweiterung ist natürlich auf die – übermäßige? – Zunahme des französischen Normbestands zurückzuführen, aber auch auf das Bestreben der Autoren, sowohl die Grundzüge des französischen Rechts zu skizzieren und gleichzeitig so präzise wie möglich zu sein. Philippe Cossalter und Julien Dubarry gelingt es hervorragend, diesen scheinbar widersprüchlichen Anspruch zu erfüllen, indem sie jeden Rechtsbereich klar darstellen, vertiefende Hinweise auf die französische und deutsche Rechtsliteratur geben und eine leicht verständliche Gliederung vorlegen." (Geleitwort von Vlad Constantinesco).
"Seit der 4. Auflage der 2001 erschienenen Einführung von Hübner/Constantinesco hat sich in der französischen Rechtsordnung so viel geändert, dass es uns angebracht erschien, das Werk von vorneherein neu zu konzipieren. Nichtdestotrotz vergessen wir nicht, was wir unseren Vorgängern zu verdanken haben: Sie haben ein Buch konzipiert, das zahlreichen Generationen von Praktikern und Studierenden an deutschsprachigen Hochschulen das französische Recht nähergebracht hat. Auch uns persönlich haben sie geprägt. Julien Dubarry durfte die Vorlesungen Hübners im deutschen Deliktsrecht und im französischen Recht an der Universität zu Köln genießen, so dass diese Erinnerung die Redaktion der zwei letzten Teile des Buches (Strafrecht und Privatrecht) stets begleitet hat. Philippe Cossalter hat die Teile 1 (Allgemeine Einführung) und 2 (Öffentliches Recht) verfasst. Auf die Darstellung der jeweiligen Sondergebiete wurde in dieser ersten Auflage, die sich im Übrigen hauptsächlich mit dem materiellen Recht befasst, verzichtet. Trotz dieser Arbeitsaufteilung wurden wir von einem gemeinsamen Ziel getrieben: eine zuverlässige, knappe und doch praxistaugliche Darstellung des geltenden Rechts anzubieten und eine Vertiefung durch Hinweise auf sorgfältig ausgewählte weiterführende französische Literatur in den Fußnoten zu ermöglichen. Literatur und Rechtsprechung konnten größtenteils bis Februar 2023 berücksichtigt werden." (Vorwort von Philippe Cossalter und Julien Dubarry).
Août 23, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GAILLET, AURORE; JESTAEDT, MATTHIAS |
|---|
| Source / Fundstelle: | La doctrine et le Conseil constitutionnel, Editions Dalloz, Paris 2024, p. 313–338 |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Droit public, Staatsrecht, Verfassungsrecht |
|---|
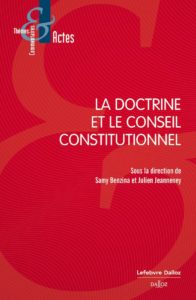
La contribution a été publiée dans l'ouvrage « La doctrine et le Conseil constitutionnel » dirigé par Julien Jeanneney et Samy Benzina, qui porte sur l'évolution des relations du Conseil constitutionnel français avec la doctrine en France. Les liens qui ont uni les professeurs de droit au sein du Conseil constitutionnel y sont étudiés.
Dans une perspective franco-allemande, la contribution analyse le rapport de la Cour fédérale allemande avec la doctrine allemande. En effet, la situation allemande offre le contraste d’une justice constitutionnelle structurellement et institutionnellement différente, et entretenant un dialogue constant et approfondi avec la doctrine. L'article examine ainsi les facteurs ayant influencé la communication étroite entre doctrine – au sens de science juridique – et pratique du droit – notamment telle qu’interprétée par la jurisprudence.
Dans une première partie, les auteurs contextualisent l'évolution historique de la relation entre la doctrine et la Cour constitutionnelle. Dans une seconde partie, l'importance de la « dogmatique » est étudiée, qui constitue un langage commun entre la Cour et la doctrine constitutionnelle. Bien que cela entraîne un enrichissement mutuel, il en découle également, de manière inévitable, pour la science du droit constitutionnel, un risque de « positivisme de la jurisprudence constitutionnelle ». Enfin, dans une troisième partie, les auteurs examinent comment il appartient à la doctrine de préciser en permanence sa position et son identité pour répondre à ces critiques.

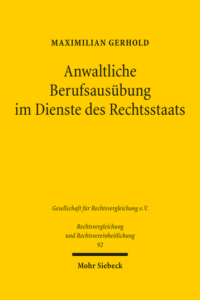 "Das Anwaltsrecht ist aus Sicht des Verfassungsrechtlers nicht nur das Recht eines Standes oder einer Profession, sondern Ausformung des Gerichtswesens und auch Recht und Staat als solches finden ihren Spiegel in ihm."
Die Arbeit befaßt sich mit der Rechtsstellung des Rechtsanwalts in Frankreich und Deutschland, namentlich der verfassungsrechtlichen Dimension. Dazu beleuchtet der Autor den verfassungsrechtlichen Schutz der anwaltlichen Berufsausübung im deutschen und französischen Verfassungsrecht und zeigt auf, inwieweit die nationalen Verfassungsrechte sich trotz grundsätzlicher und dogmatischer Unterschiede gegenseitig Impulse geben können. Der Fokus liegt insbesondere darauf, dass die Anwaltschaft kein gewöhnlicher wirtschaftlich orientierter Beruf ist, sondern eine Tätigkeit, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle innerhalb des Staatsgefüges einnimmt. Dabei sind die Anwälte nicht direkt in die staatliche Struktur eingebunden. Der Autor verwendet hierfür den Begriff der "dienenden Freiheit".
Nach einer ausführlichen Einleitung, behandelt der Autor in einem ersten Teil den besonderen Status des Rechtsanwalts. Sodann untersucht er in einem zweiten Teil die subjektiv‐rechtliche und in einem dritten Teil die objektiv‐rechtliche Dimension der anwaltlichen Freiheit. Die Arbeit schließt er mit einer knappen deutschen Bilanz und einer ausführlicheren französische Zusammenfassung ab.
"Das Anwaltsrecht ist aus Sicht des Verfassungsrechtlers nicht nur das Recht eines Standes oder einer Profession, sondern Ausformung des Gerichtswesens und auch Recht und Staat als solches finden ihren Spiegel in ihm."
Die Arbeit befaßt sich mit der Rechtsstellung des Rechtsanwalts in Frankreich und Deutschland, namentlich der verfassungsrechtlichen Dimension. Dazu beleuchtet der Autor den verfassungsrechtlichen Schutz der anwaltlichen Berufsausübung im deutschen und französischen Verfassungsrecht und zeigt auf, inwieweit die nationalen Verfassungsrechte sich trotz grundsätzlicher und dogmatischer Unterschiede gegenseitig Impulse geben können. Der Fokus liegt insbesondere darauf, dass die Anwaltschaft kein gewöhnlicher wirtschaftlich orientierter Beruf ist, sondern eine Tätigkeit, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle innerhalb des Staatsgefüges einnimmt. Dabei sind die Anwälte nicht direkt in die staatliche Struktur eingebunden. Der Autor verwendet hierfür den Begriff der "dienenden Freiheit".
Nach einer ausführlichen Einleitung, behandelt der Autor in einem ersten Teil den besonderen Status des Rechtsanwalts. Sodann untersucht er in einem zweiten Teil die subjektiv‐rechtliche und in einem dritten Teil die objektiv‐rechtliche Dimension der anwaltlichen Freiheit. Die Arbeit schließt er mit einer knappen deutschen Bilanz und einer ausführlicheren französische Zusammenfassung ab.