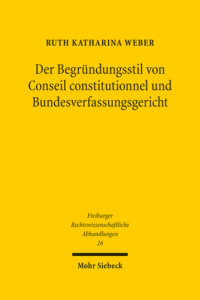Aug. 20, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | JACQUEMET-GAUCHÉ, ANNE |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV 2020, S. 453 - 460 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) |
|---|
| Année / Jahr: | 2020 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Staatsrecht, Verfassungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Entschädigung, Haftung, STAATSHAFTUNG |
|---|
 Zusammenfassung der Autorin:
Zusammenfassung der Autorin:
Der Beitrag stellt die Grundstrukturen des französischen Staatshaftungsrechts vor und führt in die dahinter stehenden Grundgedanken ein. Dabei wird sowohl auf dessen richterrechtliche Entwicklung als auch auf die Frage eingegangen, in welchem Verhältnis das französische Staatshaftungsrecht zum sozialen Entschädigungsrecht steht.
Gliederung des Beitrags:
I. Einführung
II. Das Staatshaftungs-Richterrecht des Conseil d'État
1. Der Grundsatz eines vom Zivilrecht getrennten Staatshaftungsrechts
2. Die Verschuldenshaftung (responsabilité pour faute)
3. Die Risikohaftung (responsabilité pour risque)
4. Haftung für Aufopferung (la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques)
5. Haftung für unions. und EMRK-widrige Gesetze ("La resonsabilité du fait des lois inconventionnelles")
6. Die Haftung für verfassungswidrige Gesetze
7. Prozessuale Fragen
III. Der Schaden als Angelpunkt: Staatshaftungsrecht als Opferschutz
1. Der Schaden als Angelpunkt des französischen Staatshaftungsrechts
2. Schadenersatz nur in Geld - Das Fehlen der Naturalrestitution
3. Auf dem Weg vom Staatshaftungs- zum Entschädigungsrecht?
IV. Fazit
Juli 24, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | KUTSCHER-PUIS, FABIENNE |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Zeitschrift für Vertriebsrecht, 3/2020, S. 174-178 |
|---|
| Année / Jahr: | 2020 |
|---|
| Localisation / Standort: | Zeitschrift für Vertriebsrecht |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Gesellschaftsrecht |
|---|

Das französische Gesetz vom 27. März 2017 über die Sorgfaltspflichten der Muttergesellschaften und Auftraggeber (
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre) ist das einzige umfassende Gesetz in der Europäischen Union im Bereich der Sorgfaltpflichten entlang von Lieferketten. In Deutschland besteht heute noch keine Initiative der Bundesregierung, einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Der Aufsatz fokussiert sich auf die mit einem Lieferkettengesetz verbundene Thematik und den aktuellen Rechtsrahmen sowohl in Deutschland als auch in der Euroäischen Union (I.) und das französische Gesetz von 2017 (II.).
Die Bundesrepublik hat bereits vor 2011 einen Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der Vereinten Nationen-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte am 16. Dezember 2016 verabschiedet. Ziel dieses Aktionsplans war, in unverbindlicher Weise Unternehmen aufrufen, ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht besonders entlang der eigenen Lieferkette nachzukommen. Die vorgesehenen Maßnahmen zielen darauf ab, dass die Unternehmen ein « Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte », z. B. eine Risikoanalyse der eigenen Geeschäftstätigkeit im Hinblick auf deren potentiellen Auswirkungen auf die Einhaltung der Menschenrechte durchführen oder geeignete Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle einführen. Ein erster Zwischenbericht wurde im Juli 2019 veröffentlicht : laut der mit der Auswertung beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnten nur 17% bis 19% der an der Befragung beteiligten Unternehmen darlegen, die Anforderungen des NAP an die menschenrechtliche Sorgfalt angemessen umzusetzen.
Die EU-Kommission hat 2018 einen Aktionsplan « Finanzierung nachhaltigen Wachstums » verabschiedet. Unter den Maßnahmen wird eine Bewertung geplant, ob « die Leitungsgremien der Unternehmen möglicherweise verpflichtet werden müssen, eine Nachhaltigkeittsstrategie, einschließlich angemessener Sorrgfaltspflichten in derr gesamten Lieferkette, sowie messbare Nachhaltigkeitsziele auszuarbeiten und zu veröffentlichen ». Bezüglich dieser Maßnahme wurde eine Sutidee über Sorgfalspflichten entlang von Lieferketten im Februar 2020 vorgelegt : die Mehrheit der Befragten spricht sich für die Einführung auf EU-Ebenee einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht der Unternehmen aus.
In Frankreich ist der Anwendungsbereicht des nur vier Artikel enthaltenden Gesetzes vom 27. März 2017 über die Sorgfaltspflichten der Muttergesellschaften und Auftraggeber auf größere Unternehmen beschränkt und stellt auf die Beschäftigtenanzahl im Konzen ab : Unterliegen der gesetzlichen Regelung Unternehmen, die zusammen mit ihren Tochterunternehmen im französischen Inland mindeestens 5.000 Arbeitnehmer oderr zusammen mit ihren Tochterunterrnehmen im In- und Ausland mindestens 10.000 Arbeitnehmer, während zwei Geschäftsjahren in der Folge, beschäftigen. Das französische Gesetz scheint lediglich ein Gesetz über Transparenzpflichten zu sein. Hinter dieser Fassade versteht man, dass der französische Gesetzgeber versucht hat, die CSR-Prinzipien, die anderswo als
Soft Law gelten, in ein
Hard Law umzusetzen.
Feb. 20, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GONOD, PASCALE |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: DIE VERWALTUNG , 2015, N°48,p. 337– 364 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die Verwaltung |
|---|
| Année / Jahr: | 2015 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Verwaltungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Frankreich, Rechtsexport, Verwaltungsrecht |
|---|
 Zusammenfassung des Beitrags:
Zusammenfassung des Beitrags:
Rechtsvergleichung im Rahmen des Verwaltungsrechts erscheint oft schwierig, wegen des häufig strikt nationalen Charakters des Verwaltungsrechts. Ergebnis der Geschichte des jeweiligen Staates, ist ein Export oder Import von Konzepten meist unmöglich. Trotz des nationalen Ursprungs kann man heute feststellen, dass sich auch das scheinbar in sich verschlossene französische System dank der Logik des europäischen Rechts langsam aus seiner Isolation herauskommt.
Die Rezeption unter anderem des deutschen Verwaltungsrechts in Frankreich setzt dann natürlich voraus, dass das Wissen über die deutsche Rechtskultur nicht nur erhalten, sondern auch erweitert wird. Im Zentrum dieses Gedanken stehen Forschung und Lehre der Universität, welche wesentliche Teile der Verbreitung dieses Wissens ausmachen. Daneben stehen der Conseil d’État und die Verwaltungsgerichte, welche auch bei der Verbreitung helfen.
Gliederung:
I. EInleitung
1. Ausländische Rechtsordnungen in der französischen Rechtswissenschaft
2. Deutsches Verwaltungsrecht in Frankreich
3. Nach 1945
II. Beginnender Widerstand
1. Das Verwaltungsrecht in Frnakreich - Export und Import
2. Die Mittlerrolle des Europarechts
III. Die nachhaltige Verbreitung der deutschen Rechtskultur
1. Universität
2. Verwaltungsrechtsprechung und der Conseil d'État
IV. Schlussforderungen
Feb. 12, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WEBER RUTH KATARINA |
|---|
| Source / Fundstelle: | Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht: Eine vergleichende Analyse der Spruchpraxis |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mohr Siebeck, coll. Freiburger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtspraxis, Rechtsvergleichung, Verfassungsprozeßrecht, Verfassungsrecht |
|---|
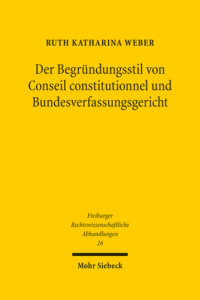
Résumé: Le style, c'est la Cour! - Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage nach dem Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht und dem darin transportierten Selbstverständnis. Dieses wurde im Ausgangspunkt für den Conseil constitutionnel als das einer autoritären "bouche de la Constitution" und für das Bundesverfassungsgericht als das einer differenzierten Verkörperung des Verfassungsrechtsstaats - die empirische Auswertung, die justizkulturelle Verankerung und die institutionellen Voraussetzungen. Der erste Teil nähert sich der dichotomen Gegenüberstellung der Begründungsstile des französischen und deutschen Verfassungsgerichts an. Mit Hilfe des Parameters der Entscheidungslänge zeigen sich wesentliche Charakteristika des Begründungsstils der beiden Gerichte. Die anfänglich sehr knappen Entscheidungen des Conseil constitutionnel in Normenkontrollverfahren werden über die Jahre immer länger. Der Anstieg der Seitenanzahl geht zum einen mit Veränderungen im Verfassungsprozessrecht einher. So stiegen mit der Verfassungsreform von 1974, nach der auch eine parlamentarische Minderheit ein Gesetz durch den Conseil constitutionnel überprüfen lassen kann, nicht nur die Verfahrenszahlen insgesamt an, sondern mit etwas Verzögerung auch die Länge der Entscheidungen. Die Entscheidungsbegründung intensivierte sich wegen ausführlich argumentierter Normenkontrollanträge und eines größeren Rechtfertigungsdrucks des fortan stärker in den politischen Prozess eingefügten Conseil constitutionnel zumindest graduell. Auch die Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden immer länger. Diese langen Entscheidungen muten wie Monographien an und behandeln die aufgeworfene Rechtsfrage über das entscheidungserhebliche Problem hinaus. Selbst aus der Perspektive der Bundesverfassungsrichter ist der Umfang der Entscheidungen zu einer "parakonstitutionellen Rechtsmasse" angewachsen. Im Vergleich zum Conseil constitutionnel werden die Entscheidungen zwar auch länger, sind aber bereits von Anfang an sehr umfangreich. Deshalb liefert die Gegenüberstellung auch die Erkenntnis, dass der Conseil constitutionnel in seiner institutionellen Position noch unsicherer ist. Während das Bundesverfassungsgericht wichtige Entscheidungen besonders ausführlich begründet, fällt die Entscheidungsbegründung des Conseil constitutionnel bei komplizierten Rechtsfragen eher knapp aus. Der zweite Teil der Arbeit behandelte die Frage nach der Verankerung des Begründungsstils auf einem abstrakten, formelhaften Niveau. In Frankreich spielt die Tradition eine ausschlaggebende Rolle. Unter Berufung auf die Französische Revolution wird der Begründungsstil der französischen Höchstgerichtsbarkeit als Ausdruck der dienenden Rolle im System der Gewaltenteilung verstanden. Die Gerichtsbarkeit legte im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem etwa durch die Abschaffung des sich als impraktikabel herausstellenden "référé législatif" ihre untergeordnete Rolle ab. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich vielfältiger einleitender und abschließender Bausteine. Das durch das Aufklärungsdenken geprägte Richterbild eines mechanischen Automaten steht in Wechselwirkung mit dem Begründungsstil französischer Höchstgerichte. Die Kritik an diesem Begründungsstil setzte rasch ein und erfuhr immer wieder Höhepunkte, wie etwa Anfang der 1970er Jahre, als André Tunc und Adolphe Touffait in einer Kampfschrift dem Begründungsstil der Cour de cassation Unzeitgemäßheit und Inhaltsleere vorwarfen. Trotz der Reformbestrebungen bleibt die Aufspaltung des jurisdiktionellen Diskurses in die Entscheidung selbst und daneben existierende, häufig der Entscheidungserläuterung dienende Begleitdokumente, wie die Rapports und Notes, weiter bestehen. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland entspringt der Begründungsstil vor allen Dingen einer über Jahrhunderte tradierten Art der Entscheidungsredaktion, die sich aus einem ganzen Bündel von Faktoren zusammensetzt. Eine Untersuchung der institutionellen Prämissen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland erfolgt im dritten Teil der Arbeit. Die ermittelten historisch gewachsenen justizkulturellen und institutionellen Prämissen bedingen das Selbstverständnis des nationalen Richters und damit dessen Begründungsstil. Die Unterschiede der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht lassen sich daher abgesehen von den justizkulturell verschiedenartig gewachsenen Gewohnheiten vor allem mit den institutionellen Grundvoraussetzungen erklären. Sie beziehen sich neben den Richtern auf das sonstige Gerichtspersonal und auf die systematische Stellung der Rechtswissenschaft.
Dez. 9, 2019
 Book description:
Book description:
The French projet d'ordonnance, which reformed contract law, the general regime of obligations and the proof of obligations appeared in February 2015. One year later, in February 2016, the final version of the ordonnance was published. The ordonnance thoroughly reforms French contract law and the law of obligations and will enter into force in October 2016.
This book results from the Contract Law Workshop of the 20th Ius Commune Conference held 26-27 November 2015. The theme of this Workshop was: 'The French Contract Law Reform: a Source of Inspiration?' Since the conference in November 2015, all authors have incorporated comments on the final version of the ordonnance.
Whereas Van Loock briefly sketches the antecedents and the outcome of the reform, the other authors each tackle specific topics of the reform that surprised and/or excited the legal community. Pannebakker tackles the precontractual phase and assesses the attractiveness of the reform for international commercial transactions. Peeraer gives a critical overview of the doctrine of nullity in the ordonnance. Leone explores the potential impact of the 'significant imbalance' test in the new ordonnance on employment contracts. In their contributions, Lutzi and Oosterhuis discuss the much-debated provision that introduces the theory of imprévision. The contributions by Jansen and Verkempinck are both focused on remedies: the newly introduced price reduction remedy and damages. Storme criticises the new rules on set-off in the ordonnance, and Mahé addresses the question why the final version of the ordonnance omitted the issue of interpersonal effects of fundamental rights on contractual freedom.
Contributions:
- Sander Van Loock - The Reform of the French Law of Obligations: How Long will the Belgians Remain Napoleon's Most Loyal Subjects?
- Ekaterina Pannebakker - Pre-Contractual Phase: Reflections on the Attractiveness of the New French Rules for the Parties to International Commercial Transactions
- Frederik Peeraer - Nullity in the Ordonnance
- Candida Leone - A Tale of Novelty and Continuity: Exploring the Future Judicial Control of Employment Contracts in the French Contract Law Reform
- Tobias Lutzi - Introducing Imprévision into French Contract Law - A Paradigm Shift in Comparative Perspective
- Janwillem (Pim) Oosterhuis - Commercial Impracticability and the Missed Opportunity of the French Contract Law Reform: Doctrinal, Historical and Law and Economics Argument - Comment on Lutzi's Introducing Imprévision into French Contract Law
- Sanne Jansen - Price Reduction unter the French Contract Law Reform
- Brecht Verkempinck - The Measure of Damages in the French Contract Law Reform - Lessons from far more Inspiring Systems
- Matthias E. Storme - Set-off in the French Reform of the Law of Obligations: a Tale of Missed Opportunities?
- Chantal Mahé - Fundamental Rights in the French Contract Law Reform

 Zusammenfassung der Autorin:
Zusammenfassung der Autorin: