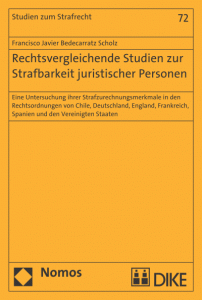Juin 6, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | ESSER, MAXIMILIAN |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Carl Heymanns Verlag, Schriftenreihe der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung, Band 45, 1. Auflage 2016. |
|---|
| Année / Jahr: | 2016 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit de la famille, Familienrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | deutsch-französische Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, Ehegüterstände, Eheliches Güterrecht, Ehescheidung, Eingetragene Lebenspartnerschaft, ZUGEWINNGEMEINSCHAFT, DIVORCE, DROIT MATRIMONIAL, PACS, PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, PARTENARIAT ENREGISTRE, PARTICIPATION AUX ACQUETS, REGIME MATRIMONIAL, Régime matrimonial optionel de participation aux acquêts, Régimes matrimoniaux |
|---|

ISBN 978-3-452-28694-9
Klappentext:
Die Internationalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen und die Globalisierung der Märkte führt zu zunehmender Mobilität der Bürger. Immer mehr Menschen wohnen in anderen Staaten als ihrem Herkunftsland, gehen private Bindungen ein und gründen Familien. Bei Ehegatten und eingetragenen Partnerschaften mit grenzüberschreitendem Bezug treten häufig praktische und rechtliche Probleme auf, wenn das Vermögen der Ehegatten oder Partner aufgeteilt werden soll. Diese Probleme hängen mit den sich zum Teil erheblich unterscheidenden Bestimmungen sowohl des internationalen Privatrechts als auch des materiellen Rechts zusammen, die für die vermögensrechtliche Auseinandersetzung nach Auflösung der Ehe oder Partnerschaft maßgebend sind. Ein Teilbereich der vermögensrechtlichen Beziehungen wird durch das eheliche Güterrecht geregelt. Die Arbeit vergleicht die für die güterrechtliche Auseinandersetzung der Ehegatten maßgeblichen Vorschriften des internationalen Privatrechts sowie des materiellen Ehegüterrechts in Deutschland und Frankreich. Zudem wird das internationale sowie materielle Güterrecht eingetragener Partnerschaften in Deutschland und Frankreich verglichen. Dabei wird insbesondere auf die geplanten EU-Verordnungen zum Ehegüterrecht und zum Güterrecht eingetragener Partnerschaften sowie auf den neu eingeführten deutsch-französischen Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft eingegangen.
Juin 5, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | CALLSEN, RAPHAËL |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Nomos, Reihe: Studien zum ausländischen, vergleichenden und internationalen Arbeitsrecht, Band 32, 1.Auflage 2015. |
|---|
| Année / Jahr: | 2015 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Arbeitsrecht, Droit du travail |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | internationales Privatrecht, Öffentliche Ordnung, Ordre public- Vorbehalt, Rom I - Verordnung, Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Rech, Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, ORDRE PUBLIC |
|---|

ISBN 978-3-8487-1947-1
Klappentext:
Welches Recht auf grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse Anwendung findet, regelt seit 2009 die Rom I-VO einheitlich auf EU-Ebene. Doch bleibt es nationalen Gerichten unbenommen, hiervon unabhängig besonders wichtigen Schutzstandards als Eingriffsnormen oder über den Ordre public-Vorbehalt Geltung zu verschaffen. In diesem Spannungsfeld zwischen Vereinheitlichung und Pluralität, Vorhersehbarkeit und Einzelfallgerechtigkeit analysiert die Arbeit die unterschiedlichen Entwicklungen in Deutschland und Frankreich und geht den Auswirkungen der Europäisierung nach.
Im Zentrum stehen dabei die Kriterien, welche die Identifizierung von Eingriffsnormen und Grundsätzen der öffentlichen Ordnung erleichtern können. Entwickelt werden differenzierte Ansätze für eine stärkere Berücksichtigung v.a. der EU-Grundrechtecharta bei der Auslegung und Anwendung der kollisionsrechtlichen Vorschriften. Dies kann im Einzelfall zur verpflichtenden Anwendung eines Mindestschutzes führen.
Mai 18, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SCHOLZ, BEDECARRATZ |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Nomos Verlagsgesellschaft, Reihe: Studien zum Strafrecht, Band 72, 1.Auflage 2016. |
|---|
| Année / Jahr: | 2016 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit pénal, Strafrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | JURISTISCHE PERSON, Personenverbände, STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT, Zurechnung, Zurechnungsnorm, Associations de personnes, Norme d'imputation, PERSONNE MORALE, RESPONSABILITE PENALE |
|---|
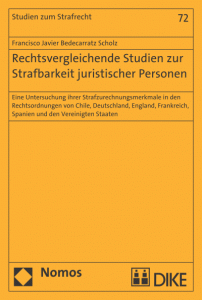
ISBN 978-3-8487-2689-9
Klappentext:
Die zunehmende Intensität des wirtschaftlichen und sozialen Lebens fördert die Entstehung von Personenvereinigungen. Diese Entwicklung birgt die Gefahr der Begehung von Straftaten, die mit einer erheblichen Sozialrelevanz verbunden sind. Darauf haben zahlreiche Staaten in den letzten Jahrzehnten reagiert und Sanktionsvorschriften gegen Personenverbände eingeführt.
Der Autor analysiert die theoretischen Grundlagen und dogmatischen Kernprobleme der Sanktionierung von juristischen Personen und sonstigen Personenvereinigungen. Dabei thematisiert er deren Zurechnungsmerkmale anhand eines umfangreichen Rechtsvergleichs von insgesamt 6 Ländern, die eine Bestrafung von Verbänden vorsehen.
Das Werk ist unerlässlich, um eine umfassende Kenntnis über die Verbandsstrafbarkeit zu erlangen und die zukünftige Entwicklung in diesem neuen Bereich des Strafrechts nachvollziehen zu können.
Mai 10, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | ALBERTS, ARNE |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Nomos, Reihe: Europäisches Privatrecht, Band 45, 1. Auflage 2015. |
|---|
| Année / Jahr: | 2015 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit civil, Zivilrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Richterliche Vertragsanpassung, Richterliche Vertragsaufhebung, Schuldrecht, Unmöglichkeit, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Avant-projet Catala, Canal de Craponne, DROIT DES OBLIGATIONS, FORCE MAJEURE, Lésion, Résiliation par le juge, Révision par le juge, Théorie de l‘imprévision |
|---|

ISBN 978-3-8487-2471-0
Klappentext:
Der Umgang mit nachträglichen Äquivalenzstörungen stellt im Bereich des Vertragsrechts eine der Problematiken dar, die in Deutschland und Frankreich sehr unterschiedlich gelöst werden. Dieses Werk zeichnet vor dem Hintergrund des deutschen Rechts die Entwicklung der „théorie de l’imprévision“ in Frankreich nach. Obwohl die französische Rechtsprechung die Berücksichtigung nachträglicher Äquivalenzstörungen traditionell ablehnte, hat sie nunmehr in Einzelfällen eine Pflicht zur Neuverhandlung festgestellt. Rechtsgrundlage, Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieser Theorie werden in diesem Buch herausgearbeitet und die Entwicklung des französischen Rechts wird in den Kontext mit französischen Reformprojekten und internationalen Vertragswerken gestellt. Es zeigt sich eine Fortentwicklung des französischen Rechts, die Parallelen zu § 313 BGB aufzeigt, aber auch neue Wege einschlägt.
Avr 20, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | FERRAND, FREDERIQUE |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: RabelsZ, 2016, S. 288-312 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht |
|---|
| Année / Jahr: | 2016 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtspraxis, Zivilrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | KASSATIONSHOF, Rechtsfortbildung |
|---|

Zusammenfassung des Autors (aus dem Englischen übersetzt):
Der Avocat général erfüllt eine besondere Aufgabe vor dem französischen Kassationshof. Er agiert nicht als öffentlicher Ankläger in strafrechtlichen und manchen zivilrechtlichen Angelegenheiten, sondern äußert eine unabhängige und unvoreingenommene Meinung zu dem Streitfall. Dieser "zweite Blick" erlaubt dem Gerichtshof nicht nur, nützlichere und relevantere Informationen, sondern auch unterschiedliche Meinungen zu bekommen und somit seine Rechtsprechung zu ändern.
Als unabhängiges Mitglied der Judikative, ohne Entscheidungsbefugnis in der Sache, können die Mitglieder des Parquet général (Generalanwaltschaft) die Einschaltung von amici curiae an den Gerichtshof in bedeutenden ethischen, sozialen und rechtlichen Fragen koordinieren.
Allerdings hat der europäische Gerichtshof für Menschenrechte Frankreich 1998 verurteilt, mit dem Vorwurf, dass diese sehr enge Zusammenarbeit und Beziehung des Avocat général zur Justiz zu einem Verstoß gegen Art. 6 (1) EMRK (Waffengleichheit und Recht auf ein faires Verfahren) führe.
Seit 2002 erhalten die Avocats généraux nicht mehr sämtliche durch den entscheidenden Richter vorbereiteten Entwürfe, sondern nur noch den offiziellen und objektiven Bericht, den auch die Parteien erhalten. Sie haben nicht mehr das Recht, den Beratungen des Senats beizuwohnen. Dies erschwert es ihnen in einigen Fällen, die Rechtsfindung nachzuvollziehen.
Jedoch zieht der Kassationshof momentan Veränderungen bezüglich der Funktionsweise in Erwägung, um die Qualität der Entscheidungsfindung zu verbessern und um von dem Einbeziehen des Avocat général in die Kassationsfälle einen größeren Nutzen zu ziehen.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung: Der Parquet général
II. Der Avocat général beim Kassationshof als hilfreicher Rechtsgutachter bis zum Jahr 2002
1. Die Aufgaben des Avocat général
2. Der beträchtliche Einfluss einiger Schlussanträge der Avocats généraux
3. Der Bruch: Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Artikel 6 (1) EMRK
III. Die Rolle des Parquet général beim Kassationshof seit dem Jahr 2002
1. Schlechte Arbeitsbedingungen, die den Einfluss des Avocat général beeinträchtigen
2. Mögliche Verbesserungen
IV. Ausblick