Das neue französische Vertragsrecht – Zur Reform des Code civil
Données bibliographiques / Bibliografische Daten | |
|---|---|
| Auteurs / Autoren: | BABUSIAUX, ULRIKE; WITZ, CLAUDE |
| Source / Fundstelle: | in: Juristenzeitung, 2017, 10, pp. 496 - 507 |
| Revue / Zeitschrift: | Juristen Zeitung (JZ) |
| Année / Jahr: | 2017 |
| Catégorie / Kategorie: | Zivilrecht |
| Mots clef / Schlagworte: | code civil, Reform, VERTRAGSRECHT, Zivilrecht |
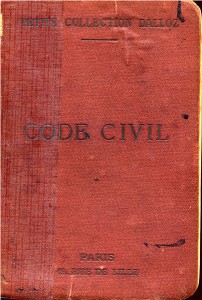
Zusammenfassung der Autoren:
Zum Oktober 2016 ist in Frankreich die umfassendste Reform des Obligationenrechts seit Bestehen des Code civil in Kraft getreten. Sie kodifiziert bestehende Rechtsprechung, beinhaltet aber auch grundlegende Neuerungen, wie den Verzicht auf die cause, die Kontrolle unangemessener Klauseln in den contrats d’adhésion und die gerichtliche Anpassung des Vertrags im Fall einer unvorhersehbaren Änderung der Umstände. Der Beitrag zeigt, wie dem Gesetzgeber im Großen und Ganzen eine Reform gelungen ist, die Tradition und Modernität geschickt miteinander verbindet.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung
II. Äußere Aspekte der Reform
- Restrukturierung des Obligationenrechts
- Umfang und Stil der neuen Artikel
III.Vertragsrecht
- "Einleitende Bestimmungen" (dispositions liminaires)
- Zustandekommen des Vertrags
- Vertragsauslegung
- Wirkungen des Vertrags
IV. Schluss




