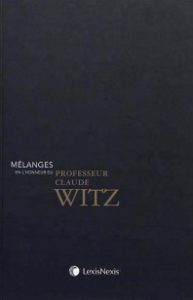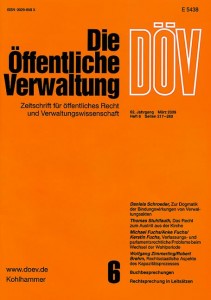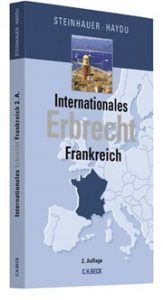Fév 12, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WEBER RUTH KATARINA |
|---|
| Source / Fundstelle: | Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht: Eine vergleichende Analyse der Spruchpraxis |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mohr Siebeck, coll. Freiburger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtspraxis, Rechtsvergleichung, Verfassungsprozeßrecht, Verfassungsrecht |
|---|
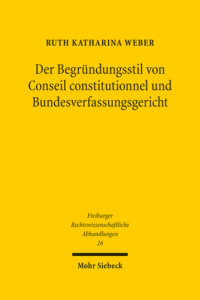
Résumé: Le style, c'est la Cour! - Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage nach dem Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht und dem darin transportierten Selbstverständnis. Dieses wurde im Ausgangspunkt für den Conseil constitutionnel als das einer autoritären "bouche de la Constitution" und für das Bundesverfassungsgericht als das einer differenzierten Verkörperung des Verfassungsrechtsstaats - die empirische Auswertung, die justizkulturelle Verankerung und die institutionellen Voraussetzungen. Der erste Teil nähert sich der dichotomen Gegenüberstellung der Begründungsstile des französischen und deutschen Verfassungsgerichts an. Mit Hilfe des Parameters der Entscheidungslänge zeigen sich wesentliche Charakteristika des Begründungsstils der beiden Gerichte. Die anfänglich sehr knappen Entscheidungen des Conseil constitutionnel in Normenkontrollverfahren werden über die Jahre immer länger. Der Anstieg der Seitenanzahl geht zum einen mit Veränderungen im Verfassungsprozessrecht einher. So stiegen mit der Verfassungsreform von 1974, nach der auch eine parlamentarische Minderheit ein Gesetz durch den Conseil constitutionnel überprüfen lassen kann, nicht nur die Verfahrenszahlen insgesamt an, sondern mit etwas Verzögerung auch die Länge der Entscheidungen. Die Entscheidungsbegründung intensivierte sich wegen ausführlich argumentierter Normenkontrollanträge und eines größeren Rechtfertigungsdrucks des fortan stärker in den politischen Prozess eingefügten Conseil constitutionnel zumindest graduell. Auch die Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden immer länger. Diese langen Entscheidungen muten wie Monographien an und behandeln die aufgeworfene Rechtsfrage über das entscheidungserhebliche Problem hinaus. Selbst aus der Perspektive der Bundesverfassungsrichter ist der Umfang der Entscheidungen zu einer "parakonstitutionellen Rechtsmasse" angewachsen. Im Vergleich zum Conseil constitutionnel werden die Entscheidungen zwar auch länger, sind aber bereits von Anfang an sehr umfangreich. Deshalb liefert die Gegenüberstellung auch die Erkenntnis, dass der Conseil constitutionnel in seiner institutionellen Position noch unsicherer ist. Während das Bundesverfassungsgericht wichtige Entscheidungen besonders ausführlich begründet, fällt die Entscheidungsbegründung des Conseil constitutionnel bei komplizierten Rechtsfragen eher knapp aus. Der zweite Teil der Arbeit behandelte die Frage nach der Verankerung des Begründungsstils auf einem abstrakten, formelhaften Niveau. In Frankreich spielt die Tradition eine ausschlaggebende Rolle. Unter Berufung auf die Französische Revolution wird der Begründungsstil der französischen Höchstgerichtsbarkeit als Ausdruck der dienenden Rolle im System der Gewaltenteilung verstanden. Die Gerichtsbarkeit legte im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem etwa durch die Abschaffung des sich als impraktikabel herausstellenden "référé législatif" ihre untergeordnete Rolle ab. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich vielfältiger einleitender und abschließender Bausteine. Das durch das Aufklärungsdenken geprägte Richterbild eines mechanischen Automaten steht in Wechselwirkung mit dem Begründungsstil französischer Höchstgerichte. Die Kritik an diesem Begründungsstil setzte rasch ein und erfuhr immer wieder Höhepunkte, wie etwa Anfang der 1970er Jahre, als André Tunc und Adolphe Touffait in einer Kampfschrift dem Begründungsstil der Cour de cassation Unzeitgemäßheit und Inhaltsleere vorwarfen. Trotz der Reformbestrebungen bleibt die Aufspaltung des jurisdiktionellen Diskurses in die Entscheidung selbst und daneben existierende, häufig der Entscheidungserläuterung dienende Begleitdokumente, wie die Rapports und Notes, weiter bestehen. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland entspringt der Begründungsstil vor allen Dingen einer über Jahrhunderte tradierten Art der Entscheidungsredaktion, die sich aus einem ganzen Bündel von Faktoren zusammensetzt. Eine Untersuchung der institutionellen Prämissen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland erfolgt im dritten Teil der Arbeit. Die ermittelten historisch gewachsenen justizkulturellen und institutionellen Prämissen bedingen das Selbstverständnis des nationalen Richters und damit dessen Begründungsstil. Die Unterschiede der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht lassen sich daher abgesehen von den justizkulturell verschiedenartig gewachsenen Gewohnheiten vor allem mit den institutionellen Grundvoraussetzungen erklären. Sie beziehen sich neben den Richtern auf das sonstige Gerichtspersonal und auf die systematische Stellung der Rechtswissenschaft.
Déc 13, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WELLER, MARC-PHILIPPE; SCHLÜRMANN LUCIENNE |
|---|
| Source / Fundstelle: | LexisNexis, 2018, pp. 893-912 |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung |
|---|
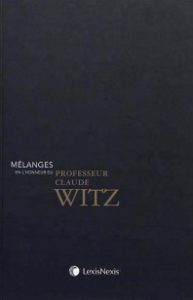
Das Internationale Privatrecht als Disziplin und dabei insbesondere die auf Savigny zurückgehende klassische Verweisungsdogmatik sowie die "Allgemeinen Lehren des IPR" stehen zur Diskussion. Kritik kommt namentlich aus Frankreich: Das "klassische" IRP und die
méthode savignienne seien im Niedergang begriffen. Dieser Beitrag möchte - im Sinne eines double approche - einen vergleichenden Blick auf die Entwicklung des Internationalen Privatrechts und seiner Methoden innerhalb beider Rechtsordnungen werfen, immerhin die "Vorreiter" der klassischen international-privatrechtlichen Dogmatik in Europa. Ein Vergleich lohnt in mehrfacher Hinsicht: So können die vergleichenden Erkenntnisse im Hinblick auf eine weitere europäische Vereinheitlichung des Kollisionsrechts fruchtbar gemacht werden, ebenso für die Entwicklung allgemeiner IPR-Lehren. Dies gilt umso mehr, als sich die deutsch-französischen (Rechts-)Beziehungen nach dem "Brexit" auch in kollisionsrechtlicher Hinsicht noch intensivieren dürften. Zunächst nimmt der Beitrag die Entwicklung der als "klassisch" bezeichneten Verweisungsmethode Savignys unter Berücksichtigung ihrer Rezeption im französischen Recht in den Blick, bevor er aus deutscher wie französischer Perspektive anhand aktueller Beispiele Herausforderungen des "modernen" Internationale Privatrechts aufzeigt.
Mai 9, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SCHNIEDERS, RALF |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV, 5/2018, S. 175 - 185 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die öffentliche Verwaltung - Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtsvergleichung |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | DATEN, INFORMATIONSRECHT |
|---|
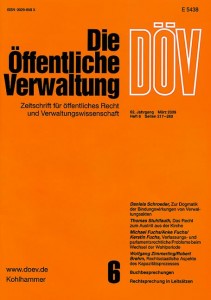 Zusammenfassung des Autors:
Zusammenfassung des Autors:
Open-(Governement)-Data (dt.: "offene Verwaltungsdaten") bezeichnet das öffentlich verfügbare Bereitstellen von Datenbeständen der öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten zur freien Weiterverwendung. Der Beitrag stellt - nach einer kurzen Darstellung der Hintergründe (I.) und des unionsrechtlichen Kontextes (II.) - die kürzlich erlassenen Open-Data-Regelungen in Frankreich (III.) und in Deutschland (IV.) vor, im Kontext der im Informationsverwaltungsrecht beider Länder seit Längerem geregelten antragsgebundenen Auskunftsansprüche des Bürgers gegenüber der Verwaltung und dem Recht auf Weiterverwendung der Daten. Abschließend werden die Regelwerke miteinander verglichen und im HInblick auf die Forderungen der Open-Data-Bewegung bewertet (V./VI.).
Gliederung des Beitrags:
I. Begriff, Ziele und kurze Historie der Normierung von Open Data
II. Unionsrechtlicher Kontext
III. Frankreich
1. Gesetz vom 17. Juli 1978
2. Einrichtung der Stabstelle Etalab
3. Loi Valter vom 28. Dezember 2105 zur Umsetzung der überarbeiteten PSI-RL
4. Loi pour une République numérique vom 7. Oktober 2016
a) Anwendungsbereich und Grundanforderungen
b) Open-Data-Tatbestände
aa) Enumerierte Datenkategorien
bb) Sogenannte Referenzdaten
cc) Neu geschaffene spezialgesetzliche Open-Data-Tatbestände
IV. Deutschland
1. Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes
2. Das Informationsweiterverwendungsgesetz
3. Bund-Länder-Koordination im Bereich Open-Data
4. Das E-Government-Gesetz
5. Der neue Open-Data-Tatbestand in § 12a EGovG
a) Persönlicher/sachlicher Anwendungsbereich
b) Ausnahmebestimmungen
c) Verhältnis zu weiteren Open-Data-Tatbeständen
d) Anforderungen an die Datenbereitstellung
V. Vergleich
VI. Fazit
Déc 15, 2017
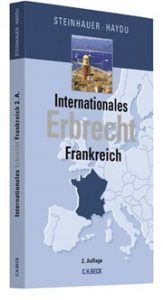
Kurztext des Verlages:
Ein Allgemeiner Teil (Steinhauer) erläutert die erbrechtlichen Aspekte des internationalen Privatrechts. Im Besonderen Teil (Steinhauer) findet sich eine ausführliche Darstellung der Grundlagen des französischen Erbrechts. Der steuerrechtliche Teil (Haydu) behandelt das französische Erbschaftsteuerrecht, die Besteuerung von grenzüberschreitenden Erbfällen, die vorweggenommene Erbfolge sowie vor allem auch Bewertungs- und Verfahrensfragen. Gestaltungsüberlegungen für deutsch-französische Erbfälle (Vermögensstrukturierung, Wahl des Wohnsitzes etc.) runden das Werk ab.
Die Neuauflage überzeugt durch eine umfassende Aktualisierung des Allgemeinen Teils und ist insbesondere um die Aspekte der Europäischen Erbrechtsverordnung ergänzt. Die Kapitel zum französischen Erbrecht sowie zur Erbschaftsteuer sind an die geltende Rechtslage angeglichen und um die praktischen Auswirkungen zahlreicher neuer Gerichtsurteile ergänzt.
Oct 10, 2017
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WELL-SZOENYI, CATHERINE |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: GRUR Int. 2017, S. 119 - 127 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil |
|---|
| Année / Jahr: | 2017 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtsvergleichung, Zivilrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | APOTHEKE, ARZNEIMITTEL, HANDEL |
|---|
 Zusammenfassung der Autorin
Zusammenfassung der Autorin:
„Das Medikament ist kein Produkt wie jedes andere“. Das war der Titel einer von der französischen Apothekenkammer lancierten Werbekampagne Anfang letzten Jahres mit dem Ziel, die wichtige Rolle der Apotheken hervorzuheben. Sollten alle Patienten ihre Medikamente künftig nur noch über das Internet beziehen, wird es in Zukunft immer weniger Apotheken geben. Der folgende Beitrag analysiert die Regelung des Versandhandels von Medikamenten in Frankreich, wo der Staat, anders als in Deutschland, dem Handel von Arzneimitteln strenge Auflagen macht.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung
II. Das Apothekenmonopol in Frankreich
1. Das Quorum-Prinzip: ein Hindernis der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) innerhalb der EU?
2. Das Apothekenmonopol: ein Verstoß gegen das Recht auf freien Warenverkehr (Art. 36 AEUV)?
3. Das Frembesitzverbot: eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs (Art. 63 AEUV)?
III. Das Monopol der Apotheker auch im Internet
1. In Deutschland
2. In Frankreich
IV. Fazit

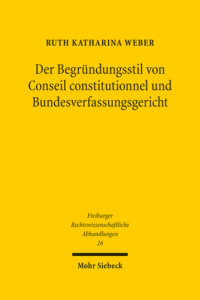 Résumé: Le style, c'est la Cour! - Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage nach dem Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht und dem darin transportierten Selbstverständnis. Dieses wurde im Ausgangspunkt für den Conseil constitutionnel als das einer autoritären "bouche de la Constitution" und für das Bundesverfassungsgericht als das einer differenzierten Verkörperung des Verfassungsrechtsstaats - die empirische Auswertung, die justizkulturelle Verankerung und die institutionellen Voraussetzungen. Der erste Teil nähert sich der dichotomen Gegenüberstellung der Begründungsstile des französischen und deutschen Verfassungsgerichts an. Mit Hilfe des Parameters der Entscheidungslänge zeigen sich wesentliche Charakteristika des Begründungsstils der beiden Gerichte. Die anfänglich sehr knappen Entscheidungen des Conseil constitutionnel in Normenkontrollverfahren werden über die Jahre immer länger. Der Anstieg der Seitenanzahl geht zum einen mit Veränderungen im Verfassungsprozessrecht einher. So stiegen mit der Verfassungsreform von 1974, nach der auch eine parlamentarische Minderheit ein Gesetz durch den Conseil constitutionnel überprüfen lassen kann, nicht nur die Verfahrenszahlen insgesamt an, sondern mit etwas Verzögerung auch die Länge der Entscheidungen. Die Entscheidungsbegründung intensivierte sich wegen ausführlich argumentierter Normenkontrollanträge und eines größeren Rechtfertigungsdrucks des fortan stärker in den politischen Prozess eingefügten Conseil constitutionnel zumindest graduell. Auch die Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden immer länger. Diese langen Entscheidungen muten wie Monographien an und behandeln die aufgeworfene Rechtsfrage über das entscheidungserhebliche Problem hinaus. Selbst aus der Perspektive der Bundesverfassungsrichter ist der Umfang der Entscheidungen zu einer "parakonstitutionellen Rechtsmasse" angewachsen. Im Vergleich zum Conseil constitutionnel werden die Entscheidungen zwar auch länger, sind aber bereits von Anfang an sehr umfangreich. Deshalb liefert die Gegenüberstellung auch die Erkenntnis, dass der Conseil constitutionnel in seiner institutionellen Position noch unsicherer ist. Während das Bundesverfassungsgericht wichtige Entscheidungen besonders ausführlich begründet, fällt die Entscheidungsbegründung des Conseil constitutionnel bei komplizierten Rechtsfragen eher knapp aus. Der zweite Teil der Arbeit behandelte die Frage nach der Verankerung des Begründungsstils auf einem abstrakten, formelhaften Niveau. In Frankreich spielt die Tradition eine ausschlaggebende Rolle. Unter Berufung auf die Französische Revolution wird der Begründungsstil der französischen Höchstgerichtsbarkeit als Ausdruck der dienenden Rolle im System der Gewaltenteilung verstanden. Die Gerichtsbarkeit legte im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem etwa durch die Abschaffung des sich als impraktikabel herausstellenden "référé législatif" ihre untergeordnete Rolle ab. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich vielfältiger einleitender und abschließender Bausteine. Das durch das Aufklärungsdenken geprägte Richterbild eines mechanischen Automaten steht in Wechselwirkung mit dem Begründungsstil französischer Höchstgerichte. Die Kritik an diesem Begründungsstil setzte rasch ein und erfuhr immer wieder Höhepunkte, wie etwa Anfang der 1970er Jahre, als André Tunc und Adolphe Touffait in einer Kampfschrift dem Begründungsstil der Cour de cassation Unzeitgemäßheit und Inhaltsleere vorwarfen. Trotz der Reformbestrebungen bleibt die Aufspaltung des jurisdiktionellen Diskurses in die Entscheidung selbst und daneben existierende, häufig der Entscheidungserläuterung dienende Begleitdokumente, wie die Rapports und Notes, weiter bestehen. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland entspringt der Begründungsstil vor allen Dingen einer über Jahrhunderte tradierten Art der Entscheidungsredaktion, die sich aus einem ganzen Bündel von Faktoren zusammensetzt. Eine Untersuchung der institutionellen Prämissen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland erfolgt im dritten Teil der Arbeit. Die ermittelten historisch gewachsenen justizkulturellen und institutionellen Prämissen bedingen das Selbstverständnis des nationalen Richters und damit dessen Begründungsstil. Die Unterschiede der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht lassen sich daher abgesehen von den justizkulturell verschiedenartig gewachsenen Gewohnheiten vor allem mit den institutionellen Grundvoraussetzungen erklären. Sie beziehen sich neben den Richtern auf das sonstige Gerichtspersonal und auf die systematische Stellung der Rechtswissenschaft.
Résumé: Le style, c'est la Cour! - Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage nach dem Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht und dem darin transportierten Selbstverständnis. Dieses wurde im Ausgangspunkt für den Conseil constitutionnel als das einer autoritären "bouche de la Constitution" und für das Bundesverfassungsgericht als das einer differenzierten Verkörperung des Verfassungsrechtsstaats - die empirische Auswertung, die justizkulturelle Verankerung und die institutionellen Voraussetzungen. Der erste Teil nähert sich der dichotomen Gegenüberstellung der Begründungsstile des französischen und deutschen Verfassungsgerichts an. Mit Hilfe des Parameters der Entscheidungslänge zeigen sich wesentliche Charakteristika des Begründungsstils der beiden Gerichte. Die anfänglich sehr knappen Entscheidungen des Conseil constitutionnel in Normenkontrollverfahren werden über die Jahre immer länger. Der Anstieg der Seitenanzahl geht zum einen mit Veränderungen im Verfassungsprozessrecht einher. So stiegen mit der Verfassungsreform von 1974, nach der auch eine parlamentarische Minderheit ein Gesetz durch den Conseil constitutionnel überprüfen lassen kann, nicht nur die Verfahrenszahlen insgesamt an, sondern mit etwas Verzögerung auch die Länge der Entscheidungen. Die Entscheidungsbegründung intensivierte sich wegen ausführlich argumentierter Normenkontrollanträge und eines größeren Rechtfertigungsdrucks des fortan stärker in den politischen Prozess eingefügten Conseil constitutionnel zumindest graduell. Auch die Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden immer länger. Diese langen Entscheidungen muten wie Monographien an und behandeln die aufgeworfene Rechtsfrage über das entscheidungserhebliche Problem hinaus. Selbst aus der Perspektive der Bundesverfassungsrichter ist der Umfang der Entscheidungen zu einer "parakonstitutionellen Rechtsmasse" angewachsen. Im Vergleich zum Conseil constitutionnel werden die Entscheidungen zwar auch länger, sind aber bereits von Anfang an sehr umfangreich. Deshalb liefert die Gegenüberstellung auch die Erkenntnis, dass der Conseil constitutionnel in seiner institutionellen Position noch unsicherer ist. Während das Bundesverfassungsgericht wichtige Entscheidungen besonders ausführlich begründet, fällt die Entscheidungsbegründung des Conseil constitutionnel bei komplizierten Rechtsfragen eher knapp aus. Der zweite Teil der Arbeit behandelte die Frage nach der Verankerung des Begründungsstils auf einem abstrakten, formelhaften Niveau. In Frankreich spielt die Tradition eine ausschlaggebende Rolle. Unter Berufung auf die Französische Revolution wird der Begründungsstil der französischen Höchstgerichtsbarkeit als Ausdruck der dienenden Rolle im System der Gewaltenteilung verstanden. Die Gerichtsbarkeit legte im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem etwa durch die Abschaffung des sich als impraktikabel herausstellenden "référé législatif" ihre untergeordnete Rolle ab. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich vielfältiger einleitender und abschließender Bausteine. Das durch das Aufklärungsdenken geprägte Richterbild eines mechanischen Automaten steht in Wechselwirkung mit dem Begründungsstil französischer Höchstgerichte. Die Kritik an diesem Begründungsstil setzte rasch ein und erfuhr immer wieder Höhepunkte, wie etwa Anfang der 1970er Jahre, als André Tunc und Adolphe Touffait in einer Kampfschrift dem Begründungsstil der Cour de cassation Unzeitgemäßheit und Inhaltsleere vorwarfen. Trotz der Reformbestrebungen bleibt die Aufspaltung des jurisdiktionellen Diskurses in die Entscheidung selbst und daneben existierende, häufig der Entscheidungserläuterung dienende Begleitdokumente, wie die Rapports und Notes, weiter bestehen. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland entspringt der Begründungsstil vor allen Dingen einer über Jahrhunderte tradierten Art der Entscheidungsredaktion, die sich aus einem ganzen Bündel von Faktoren zusammensetzt. Eine Untersuchung der institutionellen Prämissen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland erfolgt im dritten Teil der Arbeit. Die ermittelten historisch gewachsenen justizkulturellen und institutionellen Prämissen bedingen das Selbstverständnis des nationalen Richters und damit dessen Begründungsstil. Die Unterschiede der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht lassen sich daher abgesehen von den justizkulturell verschiedenartig gewachsenen Gewohnheiten vor allem mit den institutionellen Grundvoraussetzungen erklären. Sie beziehen sich neben den Richtern auf das sonstige Gerichtspersonal und auf die systematische Stellung der Rechtswissenschaft.