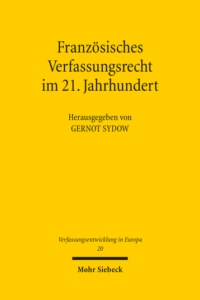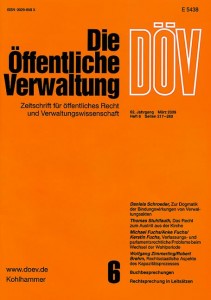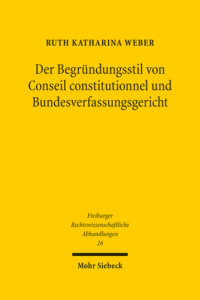Mai 14, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | AURORE GAILLET |
|---|
| Source / Fundstelle: | AöR 149 [2024], 123-191 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | AöR |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Verfassungsrecht |
|---|
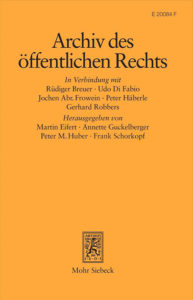
Der Beitrag behandelt das Bundesverfassungsgericht aus rechtsvergleichender französischer Sicht. Behandelt wird dabei insbesondere der französische Blickwinkel auf die Struktur des Gerichts und die Begründung seiner Entscheidungen sowie auf ausgewählte Rechtsprechungslinien, etwa in Bezug auf die Grundrechtsdogmatik oder auf die Rechtsprechung zur europäischen Integration.
Déc 31, 2022
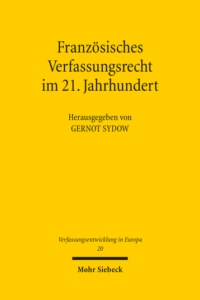
Die Verfassungsentwicklung der V. Französischen Republik seit 1958 scheint auf den ersten Blick durch ein hohes Maß an Kontinuität gekennzeichnet zu sein. Doch das französische Verfassungsrecht erweist sich gerade in den letzten Jahren als besonders innovationsoffen: etwa durch die Entwicklung neuer partizipativer Verfahren als Ergänzung der repräsentativen Demokratie und des französischen Präsidialsystems, durch die Entfaltung ausdifferenzierter umweltrechtlicher Gewährleistungen auf Verfassungsebene oder, schon 2008, durch die Einführung eines neuen verfassungsgerichtlichen Vorlageverfahrens. Die gesellschaftlichen Probleme, vor denen die französische Demokratie steht, unterscheiden sich nicht grundsätzlich von den Herausforderungen für die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die teils experimentellen französischen Erfahrungen bieten daher für die deutsche Verfassungsdiskussion wertvolle Anstöße.
Die Verfassungsentwicklung der V. Französischen Republik seit 1958 scheint auf den ersten Blick durch ein hohes Maß an Kontinuität gekennzeichnet zu sein. Doch das französische Verfassungsrecht erweist sich gerade in den letzten Jahren als besonders innovationsoffen: etwa durch die Entwicklung neuer partizipativer Verfahren als Ergänzung der repräsentativen Demokratie und des französischen Präsidialsystems, durch die Entfaltung ausdifferenzierter umweltrechtlicher Gewährleistungen auf Verfassungsebene oder, schon 2008, durch die Einführung eines neuen verfassungsgerichtlichen Vorlageverfahrens. Die gesellschaftlichen Probleme, vor denen die französische Demokratie steht, unterscheiden sich nicht grundsätzlich von den Herausforderungen für die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die teils experimentellen französischen Erfahrungen bieten daher für die deutsche Verfassungsdiskussion wertvolle Anstöße.
Inhaltsübersicht
Teil I. Einleitung
Gernot Sydow: Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert
Teil II. Historische Verfassungsprägungen: Vergewisserungen über ihre Tragfähigkeit
Madeleine Lasserre: Die Unteilbarkeit der V. Republik als politisches Prinzip –
Caroline Nacke: Das droit local als geltendes Partikularrecht in Alsace-Moselle –
Jan Niermann: Das monarchische Erbe des französischen Staatspräsidenten im System der V. Republik
Teil III. Demokratische Partizipation: Einwicklung neuer Institutionen und Verfahrensarrangements
Thea Schlütermann: Die Convention Citoyenne pour le Climat. Der Bürgerkonvent zur Klimapolitik –
Sina Maria Kemper: Die États généraux im Verfahren der Revision des Bioethikgesetzes
Teil IV. Gesellschaftliche Herausforderungen: Entfaltung des bloc de constitutionnalité
Johannes Domsgen: Die französische Umweltcharta. Normativer Befund als Teil des bloc de constitutionnalité, Rechtsprechung des Conseil Constitutionnel und Rezeption in der französischen Rechtswissenschaft –
Alban Spielkamp: (Verfassungs-)Rechtliche Rahmenbedingungen der Präimplantationsdiagnostik –
Christian Popp: Religiöse Kleidung im Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und laïcité
Teil V. Gerichtliche Kontrollkompetenzen: Überwindung des légicentrisme
Vanessa Ritter: Das Verhältnis von Question prioritaire de constitutionnalité und contrôle de conventionnalité. Zum Vorrang der Question prioritaire de constitutionnalité –
Isabelle Neise: Implikationen der Rechtsprechung der Cour de Cassation und des Conseil d'État zur konkreten Verhältnismäßigkeit
Avr 4, 2022
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GERHOLD, MAXIMILIAN |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV 2022, S. 93-102 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die öffentliche Verwaltung |
|---|
| Année / Jahr: | 2022 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Verfassungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Verfassungsrecht, Vorratsdatenspeicherung |
|---|
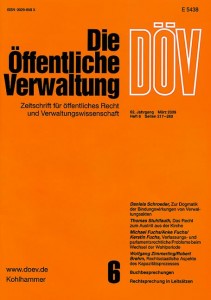 Zusammenfassung des Beitrags:
Zusammenfassung des Beitrags:
Die Auseinandersetzung um die Vorratsdatenspeicherung als Brennglas mitgliedstaatlichen und europäischen Verfassungsrechts hat mit einer Entscheidung des französischen Conseil d'Etat einen neuen - über die Vorratsdatenspeicherung hinausgehenden - gerichtlichen Twist erhalten. Der EuGH senkte im Vorjahr auf Vorlage des Conseil d'Etat seine primärrechtlichen Maßstäbe und rückte von einem strengen Verbot ab. Sobald der Rechtsstreit wieder in Paris ankam, forderte die französische Regierung jedoch das Gericht auf, das Urteil aus Luxemburg als ausbrechenden Rechtsakt unangewendet zu lassen. Die Antwort des Conseil d'Etat ist über Frankreich und den europäischen Gerichtsverbund hinaus von Interesse: Beim EuGH sind Vorlagen des Bundesverwaltungsgerichts zur deutschen Regelung anhängig und zugleich könnte 2022 der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts über Verfassungsbeschwerden hiergegen entscheiden.
Gliederung des Beitrags:
I. Die Antwort auf La Quadrature du Net als Quadratur des Kreises?
II. Paris - Luxemburg - Paris
III. Bekräftigung des eigenen Prüfungsmaßstabs
IV. Umbau des materiellen Unionsrechts
V. Schlussbemerkung
Août 20, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | JACQUEMET-GAUCHÉ, ANNE |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV 2020, S. 453 - 460 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) |
|---|
| Année / Jahr: | 2020 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Staatsrecht, Verfassungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Entschädigung, Haftung, STAATSHAFTUNG |
|---|
 Zusammenfassung der Autorin:
Zusammenfassung der Autorin:
Der Beitrag stellt die Grundstrukturen des französischen Staatshaftungsrechts vor und führt in die dahinter stehenden Grundgedanken ein. Dabei wird sowohl auf dessen richterrechtliche Entwicklung als auch auf die Frage eingegangen, in welchem Verhältnis das französische Staatshaftungsrecht zum sozialen Entschädigungsrecht steht.
Gliederung des Beitrags:
I. Einführung
II. Das Staatshaftungs-Richterrecht des Conseil d'État
1. Der Grundsatz eines vom Zivilrecht getrennten Staatshaftungsrechts
2. Die Verschuldenshaftung (responsabilité pour faute)
3. Die Risikohaftung (responsabilité pour risque)
4. Haftung für Aufopferung (la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques)
5. Haftung für unions. und EMRK-widrige Gesetze ("La resonsabilité du fait des lois inconventionnelles")
6. Die Haftung für verfassungswidrige Gesetze
7. Prozessuale Fragen
III. Der Schaden als Angelpunkt: Staatshaftungsrecht als Opferschutz
1. Der Schaden als Angelpunkt des französischen Staatshaftungsrechts
2. Schadenersatz nur in Geld - Das Fehlen der Naturalrestitution
3. Auf dem Weg vom Staatshaftungs- zum Entschädigungsrecht?
IV. Fazit
Fév 12, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WEBER RUTH KATARINA |
|---|
| Source / Fundstelle: | Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht: Eine vergleichende Analyse der Spruchpraxis |
|---|
| Année / Jahr: | 2019 |
|---|
| Localisation / Standort: | Mohr Siebeck, coll. Freiburger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtspraxis, Rechtsvergleichung, Verfassungsprozeßrecht, Verfassungsrecht |
|---|
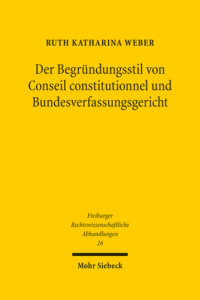
Résumé: Le style, c'est la Cour! - Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage nach dem Begründungsstil von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht und dem darin transportierten Selbstverständnis. Dieses wurde im Ausgangspunkt für den Conseil constitutionnel als das einer autoritären "bouche de la Constitution" und für das Bundesverfassungsgericht als das einer differenzierten Verkörperung des Verfassungsrechtsstaats - die empirische Auswertung, die justizkulturelle Verankerung und die institutionellen Voraussetzungen. Der erste Teil nähert sich der dichotomen Gegenüberstellung der Begründungsstile des französischen und deutschen Verfassungsgerichts an. Mit Hilfe des Parameters der Entscheidungslänge zeigen sich wesentliche Charakteristika des Begründungsstils der beiden Gerichte. Die anfänglich sehr knappen Entscheidungen des Conseil constitutionnel in Normenkontrollverfahren werden über die Jahre immer länger. Der Anstieg der Seitenanzahl geht zum einen mit Veränderungen im Verfassungsprozessrecht einher. So stiegen mit der Verfassungsreform von 1974, nach der auch eine parlamentarische Minderheit ein Gesetz durch den Conseil constitutionnel überprüfen lassen kann, nicht nur die Verfahrenszahlen insgesamt an, sondern mit etwas Verzögerung auch die Länge der Entscheidungen. Die Entscheidungsbegründung intensivierte sich wegen ausführlich argumentierter Normenkontrollanträge und eines größeren Rechtfertigungsdrucks des fortan stärker in den politischen Prozess eingefügten Conseil constitutionnel zumindest graduell. Auch die Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden immer länger. Diese langen Entscheidungen muten wie Monographien an und behandeln die aufgeworfene Rechtsfrage über das entscheidungserhebliche Problem hinaus. Selbst aus der Perspektive der Bundesverfassungsrichter ist der Umfang der Entscheidungen zu einer "parakonstitutionellen Rechtsmasse" angewachsen. Im Vergleich zum Conseil constitutionnel werden die Entscheidungen zwar auch länger, sind aber bereits von Anfang an sehr umfangreich. Deshalb liefert die Gegenüberstellung auch die Erkenntnis, dass der Conseil constitutionnel in seiner institutionellen Position noch unsicherer ist. Während das Bundesverfassungsgericht wichtige Entscheidungen besonders ausführlich begründet, fällt die Entscheidungsbegründung des Conseil constitutionnel bei komplizierten Rechtsfragen eher knapp aus. Der zweite Teil der Arbeit behandelte die Frage nach der Verankerung des Begründungsstils auf einem abstrakten, formelhaften Niveau. In Frankreich spielt die Tradition eine ausschlaggebende Rolle. Unter Berufung auf die Französische Revolution wird der Begründungsstil der französischen Höchstgerichtsbarkeit als Ausdruck der dienenden Rolle im System der Gewaltenteilung verstanden. Die Gerichtsbarkeit legte im Laufe des 19. Jahrhunderts zudem etwa durch die Abschaffung des sich als impraktikabel herausstellenden "référé législatif" ihre untergeordnete Rolle ab. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich vielfältiger einleitender und abschließender Bausteine. Das durch das Aufklärungsdenken geprägte Richterbild eines mechanischen Automaten steht in Wechselwirkung mit dem Begründungsstil französischer Höchstgerichte. Die Kritik an diesem Begründungsstil setzte rasch ein und erfuhr immer wieder Höhepunkte, wie etwa Anfang der 1970er Jahre, als André Tunc und Adolphe Touffait in einer Kampfschrift dem Begründungsstil der Cour de cassation Unzeitgemäßheit und Inhaltsleere vorwarfen. Trotz der Reformbestrebungen bleibt die Aufspaltung des jurisdiktionellen Diskurses in die Entscheidung selbst und daneben existierende, häufig der Entscheidungserläuterung dienende Begleitdokumente, wie die Rapports und Notes, weiter bestehen. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland entspringt der Begründungsstil vor allen Dingen einer über Jahrhunderte tradierten Art der Entscheidungsredaktion, die sich aus einem ganzen Bündel von Faktoren zusammensetzt. Eine Untersuchung der institutionellen Prämissen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Deutschland erfolgt im dritten Teil der Arbeit. Die ermittelten historisch gewachsenen justizkulturellen und institutionellen Prämissen bedingen das Selbstverständnis des nationalen Richters und damit dessen Begründungsstil. Die Unterschiede der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht lassen sich daher abgesehen von den justizkulturell verschiedenartig gewachsenen Gewohnheiten vor allem mit den institutionellen Grundvoraussetzungen erklären. Sie beziehen sich neben den Richtern auf das sonstige Gerichtspersonal und auf die systematische Stellung der Rechtswissenschaft.

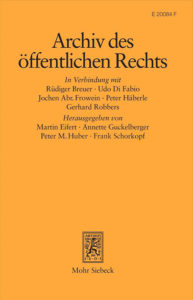 Der Beitrag behandelt das Bundesverfassungsgericht aus rechtsvergleichender französischer Sicht. Behandelt wird dabei insbesondere der französische Blickwinkel auf die Struktur des Gerichts und die Begründung seiner Entscheidungen sowie auf ausgewählte Rechtsprechungslinien, etwa in Bezug auf die Grundrechtsdogmatik oder auf die Rechtsprechung zur europäischen Integration.
Der Beitrag behandelt das Bundesverfassungsgericht aus rechtsvergleichender französischer Sicht. Behandelt wird dabei insbesondere der französische Blickwinkel auf die Struktur des Gerichts und die Begründung seiner Entscheidungen sowie auf ausgewählte Rechtsprechungslinien, etwa in Bezug auf die Grundrechtsdogmatik oder auf die Rechtsprechung zur europäischen Integration.