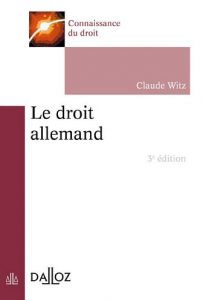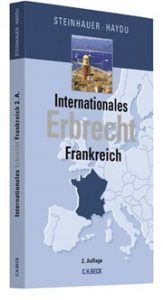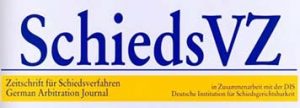Mai 9, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SCHNIEDERS, RALF |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV, 5/2018, S. 175 - 185 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die öffentliche Verwaltung - Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtsvergleichung |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | DATEN, INFORMATIONSRECHT |
|---|
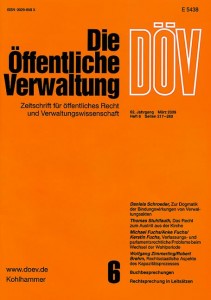 Zusammenfassung des Autors:
Zusammenfassung des Autors:
Open-(Governement)-Data (dt.: "offene Verwaltungsdaten") bezeichnet das öffentlich verfügbare Bereitstellen von Datenbeständen der öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten zur freien Weiterverwendung. Der Beitrag stellt - nach einer kurzen Darstellung der Hintergründe (I.) und des unionsrechtlichen Kontextes (II.) - die kürzlich erlassenen Open-Data-Regelungen in Frankreich (III.) und in Deutschland (IV.) vor, im Kontext der im Informationsverwaltungsrecht beider Länder seit Längerem geregelten antragsgebundenen Auskunftsansprüche des Bürgers gegenüber der Verwaltung und dem Recht auf Weiterverwendung der Daten. Abschließend werden die Regelwerke miteinander verglichen und im HInblick auf die Forderungen der Open-Data-Bewegung bewertet (V./VI.).
Gliederung des Beitrags:
I. Begriff, Ziele und kurze Historie der Normierung von Open Data
II. Unionsrechtlicher Kontext
III. Frankreich
1. Gesetz vom 17. Juli 1978
2. Einrichtung der Stabstelle Etalab
3. Loi Valter vom 28. Dezember 2105 zur Umsetzung der überarbeiteten PSI-RL
4. Loi pour une République numérique vom 7. Oktober 2016
a) Anwendungsbereich und Grundanforderungen
b) Open-Data-Tatbestände
aa) Enumerierte Datenkategorien
bb) Sogenannte Referenzdaten
cc) Neu geschaffene spezialgesetzliche Open-Data-Tatbestände
IV. Deutschland
1. Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes
2. Das Informationsweiterverwendungsgesetz
3. Bund-Länder-Koordination im Bereich Open-Data
4. Das E-Government-Gesetz
5. Der neue Open-Data-Tatbestand in § 12a EGovG
a) Persönlicher/sachlicher Anwendungsbereich
b) Ausnahmebestimmungen
c) Verhältnis zu weiteren Open-Data-Tatbeständen
d) Anforderungen an die Datenbereitstellung
V. Vergleich
VI. Fazit
Fév 21, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | WITZ, CLAUDE |
|---|
| Source / Fundstelle: | Dalloz, collection "Connaissance du droit" |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Allgemeines |
|---|
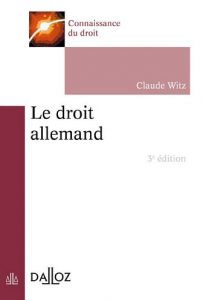
Par la généralité de son titre, l'ouvrage désormais classique de Claude Witz indique qu'il se veut une référence.
La troisième édition de "Le droit allemand", aux éditions Dalloz "Connaissance du droit" est bien l'outil indispensable pour ceux qui veulent avoir un panorama synthétique mais précis et fiable de ce droit.
L'un des intérêts évidents de l'ouvrage est l'approche simple et très explicite à un ensemble de concepts et de réalités évidents aux yeux du juriste allemand et qui ne le seront pas aux yeux de l'étudiant ou même du juriste confirmé en France : la construction historique du droit allemand, la pandectique, l'organisation juridictionnelle, etc....
Chacun des neuf chapitres de l'ouvrage est accompagné d'une bibliographie en langue française qui permet très rapidement d'approfondir ses connaissances du système juridique allemand.
L'ouvrage est destiné aux chercheurs universitaires francophones désirant commencer une recherche sur tel ou tel point du système juridique allemand, mais également aux étudiants désirant avoir des indications sur l'organisation des études de droit en Allemagne. Le premier chapitre est consacré à ce point.
- Chapitre 1 : L'accès au droit allemand
- Chapitre 2 : Structures générales
- Chapitre 3 : Structures du droit public allemand
- Chapitre 4 : Structures du droit pénal
- Chapitre 5 : Structures du droit privé
- Chapitre 6 : Principes directeurs du droit privé
- Chapitre 7 : Elements essentiels du droit civil patrimonial
- Chapitre 8 : Le juriste allemand
- Chapitre 9 : Style juridique allemand
Ph. Cossalter
Déc 15, 2017
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | BUCKLER, JULIUS |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV, 18/2017, S. 755 - 765 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die öffentliche Verwaltung- Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft |
|---|
| Année / Jahr: | 2017 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Verwaltungsrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | ATOMENERGIE, ENERGIEPOLITIK, KERNKRAFTWERK |
|---|
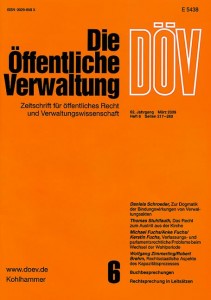
Einführung des Autors:
Während in Deutschland die ältesten Kernkraftwerke (KKW) bereits 2011 abgeschaltet wurden und alle weiteren KKW bis 2022 vom Netz gehen sollen, ist u.a. das direkt an der Grenze gelegene älteste französische KKW in Fessenheim derzeit noch in Betrieb. Es ist damit ein Sinnbild für die im Vergleich zu Deutschland vollkommen unterschiedlichen energiepolitischen Weichenstellungen und die letztlich darauf beruhende weitgehende Veränderungsresistenz des französischen Strommarktes auch gegenüber dem Strombinnenmarktprozess: Sowohl die zentrale Rolle der Kernkraft als auch die damit verbundene Dominanz der ehemaligen Monopolistin Électricité de France (EDF) als Grundpfeiler der Stromwirtschaft blieben in der Sache lange Zeit unangetastet.
Nachdem unter dem Druck der EU-Kommission seit 2009 zunächst die Vormachtstellung von EDF zurückgedrängt wurde (I.), wurden 2015 die Weichen für eine Reduzierung des Anteils der Kernkraft im Eneregiemix von zurzeit ca. 75% auf 50% bis zum Jahr 2025 gestellt (II.). Der Beitrag untersucht die Wirkungen dieses Herzstücks der französischen "Energiewende", das die Vormachtstellung von EDF jedoch nicht etwa beseitigen, sondern absehbar festigen dürfte, was neue EU-rechtliche Fragen aufwirft.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung: Die Ausgangslage auf dem französischen Strommarkt
II. Hintergrund und Eckpunkte der Reform
1. Die Motive für die Reduzierung des Kernkraftanteils
2. Die Reform als vorläufiger Endpunkt der "Transition écologique"
III. Die Reduktion der KKW-Kapazitäten
1. Das Ausbaumoratorium
a) Der formell-gesetzliche Rahmen
b) Die Möglichkeit zur energiepolitischen Feinsteuerung
2. Bewertung
a) Die Beibehaltung des Status quo
b) Der Bau neuer KKW als Monopol von EDF?
IV. Fazit
Déc 15, 2017
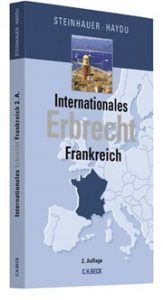
Kurztext des Verlages:
Ein Allgemeiner Teil (Steinhauer) erläutert die erbrechtlichen Aspekte des internationalen Privatrechts. Im Besonderen Teil (Steinhauer) findet sich eine ausführliche Darstellung der Grundlagen des französischen Erbrechts. Der steuerrechtliche Teil (Haydu) behandelt das französische Erbschaftsteuerrecht, die Besteuerung von grenzüberschreitenden Erbfällen, die vorweggenommene Erbfolge sowie vor allem auch Bewertungs- und Verfahrensfragen. Gestaltungsüberlegungen für deutsch-französische Erbfälle (Vermögensstrukturierung, Wahl des Wohnsitzes etc.) runden das Werk ab.
Die Neuauflage überzeugt durch eine umfassende Aktualisierung des Allgemeinen Teils und ist insbesondere um die Aspekte der Europäischen Erbrechtsverordnung ergänzt. Die Kapitel zum französischen Erbrecht sowie zur Erbschaftsteuer sind an die geltende Rechtslage angeglichen und um die praktischen Auswirkungen zahlreicher neuer Gerichtsurteile ergänzt.
Déc 12, 2017
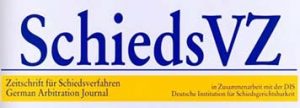 Zusammenfassung des Autors
Zusammenfassung des Autors:
Der Streit zwischen den französischen Zivil- und Verwaltungsgerichten über die Zuständigkeit hinsichtlich der Aufhebung und Vollstreckung von Schiedssprüchen, die im Rahmen von Verwaltungsverträgen ergangen sind, beeinträchtigt das Bild des französischen Schiedsrechts. Nach einer Auseinandersetzung, die einen offensichtlichen Konflikt zwischen der
Cour de cassation und dem
Conseil d’Etat enthüllte, haben die Verwaltungsgerichte die Oberhand gewonnen und wurden für zuständig erklärt. Dies bedeutet eine vertiefte inhaltliche Überprüfung der Schiedssprüche sowohl im Anfechtungs- als auch im Exequaturverfahren, die viel weiter geht als in Handelsangelegenheiten. Vertragspartner sollten sich dieser Situation bewusst sein.
Gliederung des Beitrags:
I. Einleitung
II. Die Rechtsprechung
1. Die
INSERM-Entscheidung des
Tribunal des Conflits
2. Der Rechtsstreit
SMAC gegen
Ryanair
3. Der Rechtsstreit
FOSMAX
4.
Broadband Pacific
III. Stellungnahme
1. Kommentare in der französischen Literatur
2. Einige Anmerkungen aus unserer Sicht
a) Das NYÜ und die unvollständigen prozessualen Regelungen
b) Ein Blick aus einer anderen Perspektive
IV. Fazit

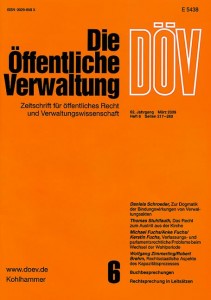 Zusammenfassung des Autors:
Zusammenfassung des Autors: