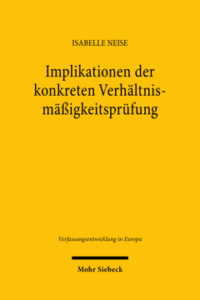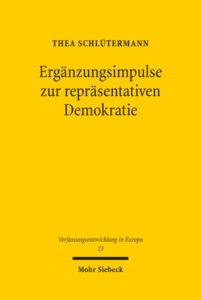Mar 20, 2025


Die Autorin erörtert eine klassische Problemstellung bezüglich der Aufgaben und Befugnisse des französischen Conseil d'État, der gleichzeitig die höchste Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit und ein die Exekutive und z.T. sogar die Legislative beratendes Organ ist. Dabei beschreibt sie die Genese der Verwaltungsgerichtsbarkeit aus dem Verbot der Einmischung der ordentlichen Gerichte in die Angelegenheiten der Verwaltung und den langen Weg zu einer unabhängigen und eigenständigen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frankreich. Sie betont insbesondere, dass bis weit in das 20. Jahrhundert die Befugnisse der Verwaltungsgerichte in Bezug auf die Verwaltung, etwa hinsichtlich der Anordnung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen oder der Anordnung von Maßnahmen der Verwaltung, weit hinter dem deutschen Recht zurückblieben und sich in der kassatorischen Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Verwaltungsmaßnahme erschöpfte.
Die Autorin zeigt sodann auf, dass durch die Gesetze vom 8. Februar 1995 und vom 30. August 2000 eine maßgebliche Stärkung der Befugnisse der Verwaltungsgerichtsbarkeit erfolgte. In diesen Kontext ordnet sie auch eine Rechtsprechungslinie in Bezug auf Verwaltungsverträge (contrats administratifs) ein, kraft derer das Gericht bei Mängeln anstelle der Auflösung bzw. Nichtigerklärung des Vertrags eine inhaltliche Anpassung desselben und nötigenfalls sogar trotz einseitiger Beendigung den weiteren Vollzug des Vertrags anordnen kann. Im letzten Teil verweist die Autorin auf drei Rechtsprechungslinien von aktueller und allgemeinpolitischer Bedeutung. Zunächst wird die relative Zurückhaltung des Conseil d'État bei seiner Rechtsprechung zu den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erläutert. Sodann wird auf die Rechtsprechung im Hinblick auf sogenannte Klimaklagen eingegangen. Hierbei betont die Autorin, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit zwar die unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen der Exekutive beanstandet hat, sich jedoch weigerte, konkrete Maßnahmen zur Abhilfe anzuordnen. Schließlich erörtert die Autorin die Rechtsprechung zu diskriminierenden Personenkontrollen. Auch hier habe der Conseil d'État festgestellt, dass eine rechtswidrige Praxis nicht nur in Einzelfällen existiere, sich aber geweigert, der Verwaltung konkrete Maßnahmen zur strukturellen Beseitigung solcher Praktiken aufzugeben.
Der Beitrag schließt mit einem Ausblick auf die aus Sicht der Autorin stetig steigenden Relevanz der nicht rechtsprechenden, sondern beratenden Funktion des Conseil d'État. Zwar betont die Autorin die funktionale Trennung der rechtsprechenden und der beratenden Sektion, gleichzeitig aber die Einheit der Institution des Conseil d'État. Insoweit stellt sie fest, dass insbesondere über die Erarbeitung von Stellungnahmen anlässlich konkreter Gesetzesvorhaben, aber auch von selbständigen Berichten und Studien in vielfältiger Weise Vorschläge für eine moderne Verwaltung von dem Conseil d'État geäußert und in den politischen Diskurs eingebracht werden.
Fév 25, 2025

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem franzöischen öffentlichen Recht der sog. Bioethik, d.h. die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eingriffe in den menschlichen Körper von besonderer ethischer Sensibilität (Transplantationsmedizin, Stammzellenforschung, Embryonenschutz etc.) und der Rechtsprechung des Conseil d'États in diesem Rechtsgebiet. Die Autoren betonen dabei die besondere Kohärenz des französischen Modells, dasauf den Grundprinzipien der Würde, der Freheit und der Solidarität beruht.
Déc 3, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | LIMPRECHT, ANNE-JACQUELINE |
|---|
| Source / Fundstelle: | Nomos Schriftenreihe der Deutsch-Französischen Juristenvereinigung |
|---|
| Année / Jahr: | 2024 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit de la concurrence, Wettbewerbsrecht |
|---|

Die Arbeit beleuchtet die hochaktuelle Problematik der Zugangsverweigerung zu Daten durch marktbeherrschende Unternehmen. In einem Rechtsvergleich untersucht der Autor, wie sich die deutsche und französische Rechtsordnung wechselseitig bereichern können, um das Kartellrecht hinsichtlich Datenzugangsfälle effektiver durchzusetzen. Dabei wird dargelegt, unter welchen Umständen marktbeherrschende Unternehmen auf Grundlage des deutschen und französischen Kartellrechts ihre Marktmacht missbrauchen, indem sie den Zugang zu eigenen Daten verweigern. Dafür wird jeweils die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland und Frankreich umfassend dargestellt. Die relevanten Normen im Zusammenhang mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung werden herausgearbeitet, gegenübergestellt und verglichen. Im Anschluss erfolgt ein Vergleich der jeweiligen Entscheidungspraxis. Die Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem nationalen deutschen und französischen Kartellrecht zu absolut und relativ marktmächtigen Unternehmen. Bezüge zum europäischen Recht erfolgen durch Verweise im nationalen Recht bzw. durch Bezüge in der nationalen Entscheidungspraxis. Geplantes und bestehendes Regulie-rungsrecht der EU wird in der vorliegenden Untersuchung weitgehend unbehandelt gelassen. Im letzten Teil werden ausgewählte einzelne Regulierungsansätze der EU in gebotener Kürze dargestellt. Gleiches gilt für missbräuchliche Verhaltensweisen unterhalb der Marktbeherrschungsschwelle.
Déc 3, 2024
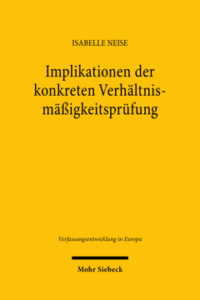
Die Arbeit untersucht die Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die französischen Gerichte, die seit einer Entscheidung der Cour de cassation im Jahr 2013 Einzelfälle im Hinblick auf Verhältnismäßigkeit beurteilen. Dies stellt eine Neuerung in der französischen Rechtsprechung dar und ist ein Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Gerichte in der Fünften Republik. Die Untersuchung beleuchtet die zugrunde liegenden Konflikte über die Rolle der Richter und den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Nach einer Einführung in die Thematik erfolgt in einem zweiten Teil eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung der Cour de cassation und des Conseil d'Etat zur konkreten Verhältnismäßigkeit. Dabei werden insbesondere die gegenläufigen Entwicklungen in der Rechtsprechung beider Gerichte beleuchtet. In einem dritten Teil werden sodann die fundamentalen Kritikpunkte an der konkreten Verhältnismäßigkeitsprüfung behandelt. Hierbei geht es um rechtsstaatliche Konflikte, die Unvereinbarkeit der Prüfung mit dem Auftrag der Cour de cassation und eine abschließende Zusammenfassung der unterschiedlichen Reaktionen der beiden Gerichte. In einem vierten Teil werden die justizkulturellen Zusammenhänge betrachtet. Der Autor behandelt dabei vornehmlich die historischen Hintergründe der französischen Justiz, die Selbstbehauptung der Cour de cassation im innerstaatlichen Gerichtsgefüge sowie die Anpassung der französischen Rechtsprechung an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dabei wird aufgezeigt, wie die Cour de cassation ihre verfassungsrechtliche Rolle in der Fünften Republik gestärkt hat. In einem fünften Teil wird ein Ausblick gegeben, der die Auswirkungen der konkreten Verhältnismäßigkeitskontrolle auf die Verfassungsmäßigkeitskontrolle des Conseil constitutionnel thematisiert. Zudem wird die französische Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der deutschen Diskussion über die Verhältnismäßigkeitskontrolle gebundener Verwaltungsentscheidungen verglichen. In einem sechsten und letzten Teil erfolgt schließlich die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.
Déc 3, 2024
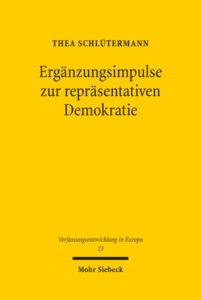
Eine stärkere Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend gefordert, sei es auf der Straße oder im Rahmen neuer demokratischer Formate wie Bürgerkonvente – ein Konzept, das in Deutschland noch in den Anfängen steckt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage nach dem verfassungsrechtlichen Raum, der für eine Vertiefung der Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung möglich ist. Der erste Teil der Arbeit hebt die Ambivalenz des deutschen verfassungsrechtlichen Diskurses in Bezug auf die Einbindung Dritter in die Gesetzgebung hervor: Während Verbände und wirtschaftliche Akteure an der Gesetzgebung beteiligt sind, ist dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht der Fall. Im zweiten Teil wird die Vorbildfunktion der Bürgerversammlung zum Klima analysiert, da es sich laut der Autorin um eine Art „Vor-Gesetzgebung“ handelte, die auch einen bindenden Effekt auf die politischen Institutionen hatte und somit über die bisherigen deutschen Erfahrungen in diesem Bereich hinausging. Im dritten und letzten Teil fasst die Autorin zusammen, wie diese unterschiedlichen Ansätze es beiden Ländern ermöglicht haben, voneinander zu lernen und Lösungen für die Forderungen der Gesellschaft nach mehr Mitwirkung an der Gesetzgebung zu finden.