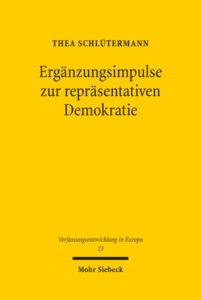
Eine stärkere Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend gefordert, sei es auf der Straße oder im Rahmen neuer demokratischer Formate wie Bürgerkonvente – ein Konzept, das in Deutschland noch in den Anfängen steckt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage nach dem verfassungsrechtlichen Raum, der für eine Vertiefung der Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung möglich ist. Der erste Teil der Arbeit hebt die Ambivalenz des deutschen verfassungsrechtlichen Diskurses in Bezug auf die Einbindung Dritter in die Gesetzgebung hervor: Während Verbände und wirtschaftliche Akteure an der Gesetzgebung beteiligt sind, ist dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht der Fall. Im zweiten Teil wird die Vorbildfunktion der Bürgerversammlung zum Klima analysiert, da es sich laut der Autorin um eine Art „Vor-Gesetzgebung“ handelte, die auch einen bindenden Effekt auf die politischen Institutionen hatte und somit über die bisherigen deutschen Erfahrungen in diesem Bereich hinausging. Im dritten und letzten Teil fasst die Autorin zusammen, wie diese unterschiedlichen Ansätze es beiden Ländern ermöglicht haben, voneinander zu lernen und Lösungen für die Forderungen der Gesellschaft nach mehr Mitwirkung an der Gesetzgebung zu finden.

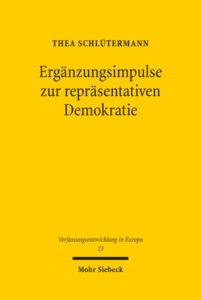 Eine stärkere Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend gefordert, sei es auf der Straße oder im Rahmen neuer demokratischer Formate wie Bürgerkonvente – ein Konzept, das in Deutschland noch in den Anfängen steckt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage nach dem verfassungsrechtlichen Raum, der für eine Vertiefung der Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung möglich ist. Der erste Teil der Arbeit hebt die Ambivalenz des deutschen verfassungsrechtlichen Diskurses in Bezug auf die Einbindung Dritter in die Gesetzgebung hervor: Während Verbände und wirtschaftliche Akteure an der Gesetzgebung beteiligt sind, ist dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht der Fall. Im zweiten Teil wird die Vorbildfunktion der Bürgerversammlung zum Klima analysiert, da es sich laut der Autorin um eine Art „Vor-Gesetzgebung“ handelte, die auch einen bindenden Effekt auf die politischen Institutionen hatte und somit über die bisherigen deutschen Erfahrungen in diesem Bereich hinausging. Im dritten und letzten Teil fasst die Autorin zusammen, wie diese unterschiedlichen Ansätze es beiden Ländern ermöglicht haben, voneinander zu lernen und Lösungen für die Forderungen der Gesellschaft nach mehr Mitwirkung an der Gesetzgebung zu finden.
Eine stärkere Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend gefordert, sei es auf der Straße oder im Rahmen neuer demokratischer Formate wie Bürgerkonvente – ein Konzept, das in Deutschland noch in den Anfängen steckt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage nach dem verfassungsrechtlichen Raum, der für eine Vertiefung der Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung möglich ist. Der erste Teil der Arbeit hebt die Ambivalenz des deutschen verfassungsrechtlichen Diskurses in Bezug auf die Einbindung Dritter in die Gesetzgebung hervor: Während Verbände und wirtschaftliche Akteure an der Gesetzgebung beteiligt sind, ist dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht der Fall. Im zweiten Teil wird die Vorbildfunktion der Bürgerversammlung zum Klima analysiert, da es sich laut der Autorin um eine Art „Vor-Gesetzgebung“ handelte, die auch einen bindenden Effekt auf die politischen Institutionen hatte und somit über die bisherigen deutschen Erfahrungen in diesem Bereich hinausging. Im dritten und letzten Teil fasst die Autorin zusammen, wie diese unterschiedlichen Ansätze es beiden Ländern ermöglicht haben, voneinander zu lernen und Lösungen für die Forderungen der Gesellschaft nach mehr Mitwirkung an der Gesetzgebung zu finden.
