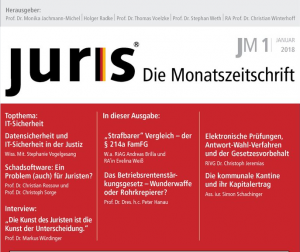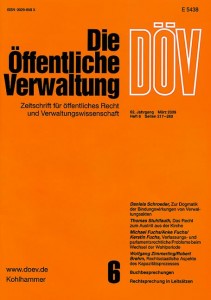Sep 10, 2018
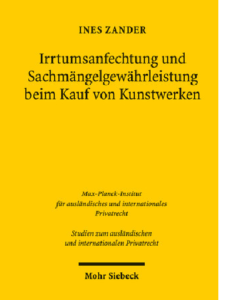 Kurztext des Verlags:
Kurztext des Verlags:
Rekorderlöse auf internationalen Auktionen einerseits und Skandale um Fälschungen andererseits – das sind die Themen, an die man denkt, wenn es um den Handel mit Kunstwerken geht. Besonders die Herkunft älterer Kunstwerke ist oft ungewiss, sodass sich bestehende Zuordnungen durch Neubestimmungen verändern können. Dies kann für einen Käufer, der ein Kunstwerk in der Erwartung erworben hat, es stamme von einem bestimmten Künstler, aus einer bestimmten Schule oder Periode, erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Andererseits kann auch der Verkäufer Nachteile erleiden, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er unwissentlich ein Meisterwerk veräußert hat. Unter Anwendung der rechtsvergleichenden Methode beleuchtet Ines Zander die Rechtsbehelfe von Käufern und Verkäufern beim Kauf von Kunstwerken, die sich als nicht authentisch erweisen oder deren Echtheit zweifelhaft wird und zieht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der rechtsvergleichenden Untersuchung Schlussfolgerungen für das deutsche Recht.
Juin 11, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | LUCAS-SCHLOETTER, AGNES |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: ZUM 2018, S. 494 - 497 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Medienrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | KUNSTWERK, URHEBERRECHT |
|---|
 Zusammenfassung:
Zusammenfassung:
Bei dem Beitrag handelt es sich um einen Vortrag auf dem Symposium "Kunst und (Urheber-)Recht" des Instituts für Urheber- und Medienrecht am 13. April 2018 in München. Die Autorin liefert einen Einblick in die bestehenden Regelungen im deutschen und im französischen Recht zur Panoramafreiheit, welche die Abbildung sich bleibend in der Öffentlichkeit befindender Werke sowie deren Nutzung erlaubt.
Gliederung des Beirags:
I. Einleitung
II. Deutsche Rechtslage
III. Französische Rechtslage
IV. Ausblick
Mai 23, 2018
 Kurztext des Verlags
Kurztext des Verlags:
Das Werk analysiert aus einem deutschem Blickwinkel das im französischen Strafverfahren weitreichendste konsensuale Verfahren („Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité“) und setzt es in Bezug zu weiteren konsensualen Verfahren im französischen und deutschen Strafprozess. Der Staatsanwalt schlägt in diesem Verfahren dem geständigen Beschuldigten die Strafe vor, der Richter bestätigt sie nach öffentlicher Anhörung des Beschuldigten. Die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Strafverfahrens wird geprüft und die Besonderheiten des Verfahrens (Pflichtverteidigung, Trennung vom herkömmlichen Verfahren, Geständnis im Vorfeld, öffentliche richterliche Überprüfung, Ausschluss von Tätergruppen, die anfällig für falsche Geständnisse sind, eingeschränkter Anwendungsbereich und Rechtsfolgen) werden erläutert. Durch Darstellung von statistischen Erhebungen und Studien wird die praktische Relevanz der diskutierten Fragestellungen und dargestellten Verfahrensarten verdeutlicht.
Mai 15, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | BRITZ, GUIDO |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: JM 4/2018, S. 167 - 170 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Juris - Die Monatszeitschrift |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Strafprozeßrecht, Strafrecht |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | Absprachen, STRAFVERFAHREN |
|---|
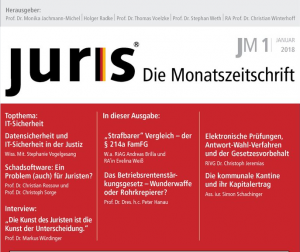 Zusammenfassung:
Zusammenfassung:
Der Verfasser geht in seinem Beitrag näher auf die seit 2004 in Frankreich bestehenden Vorschriften zur strafrechtlichen Absprache, zu der Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) ein. Er bietet zunächst einen Überblick über die bestehenden Regelungen, um diese dann einen größeren Kontext einzuordnen und schließlich zu einer rechtsvergleichenden Betrachtung zu kommen.
Gliederung des Beitrags:
A. Einleitung
B. Zum Inhalt der C.R.P.C.
I. Zum Anwendungsbereich der C.R.P.C.
II.Zum Verfahren der C.R.P.C.
III. Zu den Sanktionen im Rahmen der C.R.P.C.
C. Zur Einordnung und zu den Perspektiven der C.R.P.C.
D. Zur strafrechtsvergleichenden Bewertung
Mai 9, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | SCHNIEDERS, RALF |
|---|
| Source / Fundstelle: | in: DÖV, 5/2018, S. 175 - 185 |
|---|
| Revue / Zeitschrift: | Die öffentliche Verwaltung - Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft |
|---|
| Année / Jahr: | 2018 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Rechtsvergleichung |
|---|
| Mots clef / Schlagworte: | DATEN, INFORMATIONSRECHT |
|---|
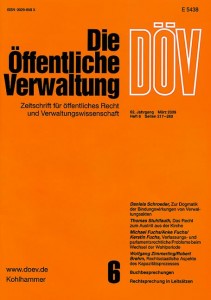 Zusammenfassung des Autors:
Zusammenfassung des Autors:
Open-(Governement)-Data (dt.: "offene Verwaltungsdaten") bezeichnet das öffentlich verfügbare Bereitstellen von Datenbeständen der öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten zur freien Weiterverwendung. Der Beitrag stellt - nach einer kurzen Darstellung der Hintergründe (I.) und des unionsrechtlichen Kontextes (II.) - die kürzlich erlassenen Open-Data-Regelungen in Frankreich (III.) und in Deutschland (IV.) vor, im Kontext der im Informationsverwaltungsrecht beider Länder seit Längerem geregelten antragsgebundenen Auskunftsansprüche des Bürgers gegenüber der Verwaltung und dem Recht auf Weiterverwendung der Daten. Abschließend werden die Regelwerke miteinander verglichen und im HInblick auf die Forderungen der Open-Data-Bewegung bewertet (V./VI.).
Gliederung des Beitrags:
I. Begriff, Ziele und kurze Historie der Normierung von Open Data
II. Unionsrechtlicher Kontext
III. Frankreich
1. Gesetz vom 17. Juli 1978
2. Einrichtung der Stabstelle Etalab
3. Loi Valter vom 28. Dezember 2105 zur Umsetzung der überarbeiteten PSI-RL
4. Loi pour une République numérique vom 7. Oktober 2016
a) Anwendungsbereich und Grundanforderungen
b) Open-Data-Tatbestände
aa) Enumerierte Datenkategorien
bb) Sogenannte Referenzdaten
cc) Neu geschaffene spezialgesetzliche Open-Data-Tatbestände
IV. Deutschland
1. Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes
2. Das Informationsweiterverwendungsgesetz
3. Bund-Länder-Koordination im Bereich Open-Data
4. Das E-Government-Gesetz
5. Der neue Open-Data-Tatbestand in § 12a EGovG
a) Persönlicher/sachlicher Anwendungsbereich
b) Ausnahmebestimmungen
c) Verhältnis zu weiteren Open-Data-Tatbeständen
d) Anforderungen an die Datenbereitstellung
V. Vergleich
VI. Fazit

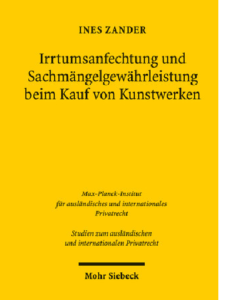 Kurztext des Verlags:
Kurztext des Verlags: