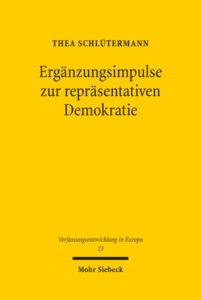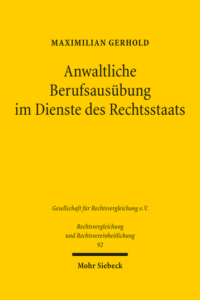Déc 3, 2024
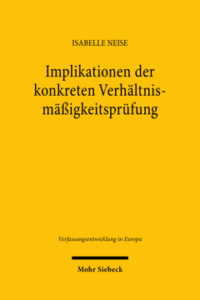
Die Arbeit untersucht die Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die französischen Gerichte, die seit einer Entscheidung der Cour de cassation im Jahr 2013 Einzelfälle im Hinblick auf Verhältnismäßigkeit beurteilen. Dies stellt eine Neuerung in der französischen Rechtsprechung dar und ist ein Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Gerichte in der Fünften Republik. Die Untersuchung beleuchtet die zugrunde liegenden Konflikte über die Rolle der Richter und den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Nach einer Einführung in die Thematik erfolgt in einem zweiten Teil eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung der Cour de cassation und des Conseil d'Etat zur konkreten Verhältnismäßigkeit. Dabei werden insbesondere die gegenläufigen Entwicklungen in der Rechtsprechung beider Gerichte beleuchtet. In einem dritten Teil werden sodann die fundamentalen Kritikpunkte an der konkreten Verhältnismäßigkeitsprüfung behandelt. Hierbei geht es um rechtsstaatliche Konflikte, die Unvereinbarkeit der Prüfung mit dem Auftrag der Cour de cassation und eine abschließende Zusammenfassung der unterschiedlichen Reaktionen der beiden Gerichte. In einem vierten Teil werden die justizkulturellen Zusammenhänge betrachtet. Der Autor behandelt dabei vornehmlich die historischen Hintergründe der französischen Justiz, die Selbstbehauptung der Cour de cassation im innerstaatlichen Gerichtsgefüge sowie die Anpassung der französischen Rechtsprechung an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dabei wird aufgezeigt, wie die Cour de cassation ihre verfassungsrechtliche Rolle in der Fünften Republik gestärkt hat. In einem fünften Teil wird ein Ausblick gegeben, der die Auswirkungen der konkreten Verhältnismäßigkeitskontrolle auf die Verfassungsmäßigkeitskontrolle des Conseil constitutionnel thematisiert. Zudem wird die französische Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der deutschen Diskussion über die Verhältnismäßigkeitskontrolle gebundener Verwaltungsentscheidungen verglichen. In einem sechsten und letzten Teil erfolgt schließlich die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.
Déc 3, 2024
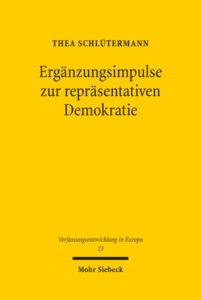
Eine stärkere Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend gefordert, sei es auf der Straße oder im Rahmen neuer demokratischer Formate wie Bürgerkonvente – ein Konzept, das in Deutschland noch in den Anfängen steckt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage nach dem verfassungsrechtlichen Raum, der für eine Vertiefung der Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung möglich ist. Der erste Teil der Arbeit hebt die Ambivalenz des deutschen verfassungsrechtlichen Diskurses in Bezug auf die Einbindung Dritter in die Gesetzgebung hervor: Während Verbände und wirtschaftliche Akteure an der Gesetzgebung beteiligt sind, ist dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht der Fall. Im zweiten Teil wird die Vorbildfunktion der Bürgerversammlung zum Klima analysiert, da es sich laut der Autorin um eine Art „Vor-Gesetzgebung“ handelte, die auch einen bindenden Effekt auf die politischen Institutionen hatte und somit über die bisherigen deutschen Erfahrungen in diesem Bereich hinausging. Im dritten und letzten Teil fasst die Autorin zusammen, wie diese unterschiedlichen Ansätze es beiden Ländern ermöglicht haben, voneinander zu lernen und Lösungen für die Forderungen der Gesellschaft nach mehr Mitwirkung an der Gesetzgebung zu finden.
Déc 3, 2024
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
|---|
| Auteurs / Autoren: | GERHOLD, MAXIMILIAN |
|---|
| Source / Fundstelle: | IN: Mohr Siebeck, Reihe: Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, 2023. |
|---|
| Année / Jahr: | 2023 |
|---|
| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Verfassungsrecht |
|---|
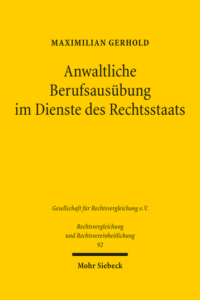
"Das Anwaltsrecht ist aus Sicht des Verfassungsrechtlers nicht nur das Recht eines Standes oder einer Profession, sondern Ausformung des Gerichtswesens und auch Recht und Staat als solches finden ihren Spiegel in ihm."
Die Arbeit befaßt sich mit der Rechtsstellung des Rechtsanwalts in Frankreich und Deutschland, namentlich der verfassungsrechtlichen Dimension. Dazu beleuchtet der Autor den verfassungsrechtlichen Schutz der anwaltlichen Berufsausübung im deutschen und französischen Verfassungsrecht und zeigt auf, inwieweit die nationalen Verfassungsrechte sich trotz grundsätzlicher und dogmatischer Unterschiede gegenseitig Impulse geben können. Der Fokus liegt insbesondere darauf, dass die Anwaltschaft kein gewöhnlicher wirtschaftlich orientierter Beruf ist, sondern eine Tätigkeit, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle innerhalb des Staatsgefüges einnimmt. Dabei sind die Anwälte nicht direkt in die staatliche Struktur eingebunden. Der Autor verwendet hierfür den Begriff der "dienenden Freiheit".
Nach einer ausführlichen Einleitung, behandelt der Autor in einem ersten Teil den besonderen Status des Rechtsanwalts. Sodann untersucht er in einem zweiten Teil die subjektiv‐rechtliche und in einem dritten Teil die objektiv‐rechtliche Dimension der anwaltlichen Freiheit. Die Arbeit schließt er mit einer knappen deutschen Bilanz und einer ausführlicheren französische Zusammenfassung ab.
Nov 25, 2024

Zusammenfassung des Autors: Paritätisches Wahlrecht hat zum Ziel, geschlechtergerechte Zugangsmöglichkeiten zum Parlament zu schaffen. Der Autor betrachtet die in Deutschland kontrovers diskutierte Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit aus rechtsvergleichender Perspektive. Die verfassungsrechtliche Lage in Frankreich steht dabei in erstaunlichem Kontrast zur deutschen Diskussion. Dazu beginnt die Autorin mit einer Begriffsbestimmung von Parität und Frauenquoten und gibt einen Überblick über Modelle zur Steigerung des Frauenanteils in politischen Gremien. Anschließend folgt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in beiden Ländern sowie ein historischer Überblick zur Entwicklung des paritätischen Wahlrechts. Es werden mögliche Beeinträchtigungen durch das paritätische Wahlrecht erörtert, insbesondere im Hinblick auf die Gleichheit und Freiheit der Wahl sowie die politischen Parteien. Abschließend untersucht die Autorin Rechtfertigungsmöglichkeiten und die Umsetzung paritätischer Maßnahmen im deutschen und französischen Recht, um deren Zulässigkeit zu beurteilen.
Nov 25, 2024

Une influence accrue des citoyennes et citoyens est désormais réclamée, que ce soit dans la rue, ou dans le cadre de nouveaux formats démocratiques tels que les conventions citoyennes ; un concept, qui, en Allemagne, n’en est qu’à ses débuts. Dans cette perspective, la question clé est celle de l’espace constitutionnel envisageable pour un approfondissement de la participation citoyenne à la formation de la loi.
La première partie de l'article souligne l'ambivalence du discours constitutionnel allemand en ce qui concerne l'implication de tiers dans la législation : Alors que les associations et les acteurs économiques participent à l'élaboration de la législation, ce n'est pas le cas des citoyens. Dans une deuxième partie, la fonction d'exemple de la Convention des citoyens pour le climat est analysée, car il s'agissait, selon l'auteur, d'une sorte de « pré-législation » qui s'accompagnait également d'un effet contraignant pour les institutions politiques, dépassant ainsi les expériences allemandes dans ce domaine. Dans une troisième et dernière partie, l'auteur résume comment ces différentes approches ont permis aux deux pays de s'inspirer mutuellement et de trouver des solutions aux demandes de la société de participer davantage à l'élaboration des lois.

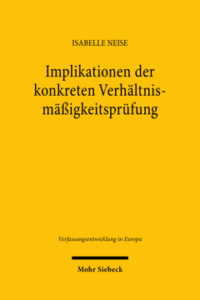 Die Arbeit untersucht die Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die französischen Gerichte, die seit einer Entscheidung der Cour de cassation im Jahr 2013 Einzelfälle im Hinblick auf Verhältnismäßigkeit beurteilen. Dies stellt eine Neuerung in der französischen Rechtsprechung dar und ist ein Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Gerichte in der Fünften Republik. Die Untersuchung beleuchtet die zugrunde liegenden Konflikte über die Rolle der Richter und den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Nach einer Einführung in die Thematik erfolgt in einem zweiten Teil eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung der Cour de cassation und des Conseil d'Etat zur konkreten Verhältnismäßigkeit. Dabei werden insbesondere die gegenläufigen Entwicklungen in der Rechtsprechung beider Gerichte beleuchtet. In einem dritten Teil werden sodann die fundamentalen Kritikpunkte an der konkreten Verhältnismäßigkeitsprüfung behandelt. Hierbei geht es um rechtsstaatliche Konflikte, die Unvereinbarkeit der Prüfung mit dem Auftrag der Cour de cassation und eine abschließende Zusammenfassung der unterschiedlichen Reaktionen der beiden Gerichte. In einem vierten Teil werden die justizkulturellen Zusammenhänge betrachtet. Der Autor behandelt dabei vornehmlich die historischen Hintergründe der französischen Justiz, die Selbstbehauptung der Cour de cassation im innerstaatlichen Gerichtsgefüge sowie die Anpassung der französischen Rechtsprechung an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dabei wird aufgezeigt, wie die Cour de cassation ihre verfassungsrechtliche Rolle in der Fünften Republik gestärkt hat. In einem fünften Teil wird ein Ausblick gegeben, der die Auswirkungen der konkreten Verhältnismäßigkeitskontrolle auf die Verfassungsmäßigkeitskontrolle des Conseil constitutionnel thematisiert. Zudem wird die französische Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der deutschen Diskussion über die Verhältnismäßigkeitskontrolle gebundener Verwaltungsentscheidungen verglichen. In einem sechsten und letzten Teil erfolgt schließlich die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.
Die Arbeit untersucht die Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die französischen Gerichte, die seit einer Entscheidung der Cour de cassation im Jahr 2013 Einzelfälle im Hinblick auf Verhältnismäßigkeit beurteilen. Dies stellt eine Neuerung in der französischen Rechtsprechung dar und ist ein Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Gerichte in der Fünften Republik. Die Untersuchung beleuchtet die zugrunde liegenden Konflikte über die Rolle der Richter und den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Nach einer Einführung in die Thematik erfolgt in einem zweiten Teil eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung der Cour de cassation und des Conseil d'Etat zur konkreten Verhältnismäßigkeit. Dabei werden insbesondere die gegenläufigen Entwicklungen in der Rechtsprechung beider Gerichte beleuchtet. In einem dritten Teil werden sodann die fundamentalen Kritikpunkte an der konkreten Verhältnismäßigkeitsprüfung behandelt. Hierbei geht es um rechtsstaatliche Konflikte, die Unvereinbarkeit der Prüfung mit dem Auftrag der Cour de cassation und eine abschließende Zusammenfassung der unterschiedlichen Reaktionen der beiden Gerichte. In einem vierten Teil werden die justizkulturellen Zusammenhänge betrachtet. Der Autor behandelt dabei vornehmlich die historischen Hintergründe der französischen Justiz, die Selbstbehauptung der Cour de cassation im innerstaatlichen Gerichtsgefüge sowie die Anpassung der französischen Rechtsprechung an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dabei wird aufgezeigt, wie die Cour de cassation ihre verfassungsrechtliche Rolle in der Fünften Republik gestärkt hat. In einem fünften Teil wird ein Ausblick gegeben, der die Auswirkungen der konkreten Verhältnismäßigkeitskontrolle auf die Verfassungsmäßigkeitskontrolle des Conseil constitutionnel thematisiert. Zudem wird die französische Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der deutschen Diskussion über die Verhältnismäßigkeitskontrolle gebundener Verwaltungsentscheidungen verglichen. In einem sechsten und letzten Teil erfolgt schließlich die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.